Aktuelle CME
Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.





Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie u. Internistische Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin;
Senior Consultant
Ludwig-Maximilians Universität (LMU);
Ärztlicher Direktor und Gesellschafter
Interdisziplinäres Onkologisches Zentrum (IOZ), München
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie
Impfen bei Tumorerkrankungen: Alles Wichtige auf einen Blick
Impfen bei Tumorerkrankungen: Alles Wichtige auf einen Blick
Diese Fortbildung gibt Ihnen einen umfassenden und informativen Überblick über die Impfmöglichkeiten bei Tumorpatienten mit Blick auf die wichtigsten Implikationen und daraus resultierenden Empfehlungen bei einer antineoplastischen Therapie.
Nach einer Einführung in die Epidemiologie und das Infektionsrisiko bei Tumorerkrankungen wird die antineoplastische Therapie schwerpunktmäßig vorgestellt. Vor dem Hintergrund, dass dieser Therapieansatz den durch frühere Impfungen bzw. Infektionen erworbenen Immunschutz beeinträchtigen und damit das Infektionsrisiko der Patienten erhöhen kann, wird in dieser eCME gezielt auf die Impfung unter sowie nach einer antineoplastischen Therapie eingegangen. Dabei werden Impfzeitpunkt, -wirksamkeit, -sicherheit sowie der Einfluss unterschiedlicher Therapeutika auf das Impfansprechen näher beleuchtet und entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.




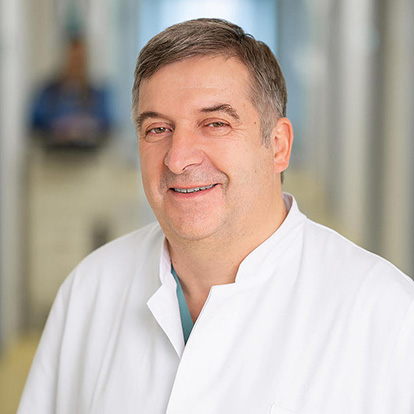
Chefarzt der Frauenklinik
Evangelisches Klinikum Weyertal
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin
Die hormonelle Notfall-Kontrazeption - Wissenswertes zur „Pille danach“
Die hormonelle Notfall-Kontrazeption - Wissenswertes zur „Pille danach“
Wann ist die Notfallkontrazeption indiziert? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie wirken die oralen Notfallkontrazeptiva? Prof. Römer von der Frauenklinik, Evangelisches Klinikum Köln, gibt Antworten auf diese Fragen und informiert darüber hinaus über den Umgang mit Patientinnen in speziellen Situationen. Die oralen Kontrazeptiva sind freiverkäuflich in der Apotheke erhältlich. Welche Synergien kann das in der medizinischen Versorgung bringen? Informationen für das praktische Management im Alltag mit den Patientinnen runden die Fortbildung ab.





Facharzt für Urologie
ehem. Ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie, Universitätsklinikum Freiburg; Lehrstuhl für Urologie und Andrologie an der DPU im Krems, Österreich; alta uro, Medizinisches Zentrum für Urologie in Basel, Schweiz
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie / Urologie
Testosteron und sexuelle Funktion
Testosteron und sexuelle Funktion
Die sexuelle Aktivität sowie Potenz des Mannes werden häufig in Zusammenhang mit dem Testosteronspiegel gesehen. Das sexuelle Verlangen, die Libido, nimmt meist mit dem Alter ab. Befragungen zeigen jedoch, dass sexuelle Gedanken auch bei älteren Männern weiterhin vorhanden sind. Allerdings ist nicht nur die Libido, sondern auch die Erektion testosteronabhängig.
Häufig wird ein Testosteronmangel als Ursache von Libidoverlust oder Erektionsstörungen nicht erkannt, da eine routinemäßige Kontrolle des Testosteronspiegels bei diesen Störungen nicht allgemein etabliert ist. Warum dies sinnvoll ist und wie Sie betroffenen Männer helfen können, erfahren Sie in unserer Fortbildung.



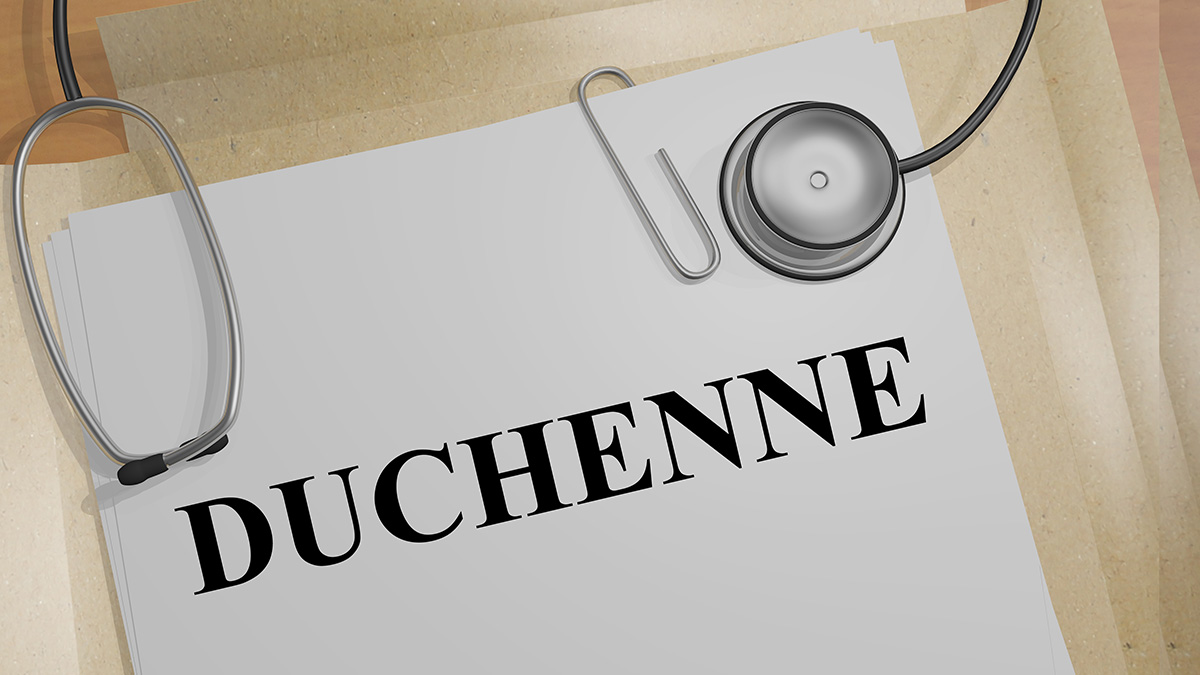

Oberarzt (Sektion Neuropädiatrie und Stoffwechselmedizin)
Ärztliche Leitung (paedKliPS (Pädiatrisches Klinisch-Pharmakologisches Studienzentrum))
Projektleitung (INTEGRATE-ATMP)
Universitätsklinikum Heidelberg
- Kinder- und Jugendmedizin / Neurologie / Kardiologie / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie
Duchenne Muskeldystrophie
Duchenne Muskeldystrophie
Diese eCME führt strukturiert in die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ein und beleuchtet die Pathophysiologie weit über den klassischen Membrandefekt hinaus. Anhand aktueller wissenschaftlicher Daten werden zentrale Mechanismen wie gestörte Calciumhomöostase, mitochondriale Dysfunktion, Veränderungen der NO-Signalwege, epigenetische Regulation durch HDAC-Aktivität sowie die Rolle von Satellitenzellen, FAP-Zellen und Immunzellen verständlich dargestellt. Ergänzend bietet das Modul einen Überblick über etablierte und neue Therapieansätze, inklusive genetischer und epigenetischer Strategien, sowie über den Einfluss dieser Behandlungen auf Funktion, Progression und Lebensqualität von DMD-Patienten.





Facharzt für Innere Medizin / Diabetologie
Diabeteszentrum Lüneburger Heide, Soltau
- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin
Aktuelle Diabetestherapie in der Praxis: Mehr als nur Blutzuckersenkung!
Aktuelle Diabetestherapie in der Praxis: Mehr als nur Blutzuckersenkung!
Diese an der Praxis orientierte Fortbildung richtet sich insbesondere an Hausärztinnen und Hausärzte, die ihren Diabetes-Patienten eine fundierte und evidenzbasierte Therapie anbieten möchten. Herr Dr. Klask geht auf alle zur Verfügung stehenden Substanzgruppen ein und erörtert, auch anhand von Kasuistiken, das Für und Wider in der Therapiewahl unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Patiententypen hinsichtlich Risikoprofil und Nebenwirkungsmanagement. Zudem erfahren Sie, warum Metformin nach wie vor als Basistherapie gilt und welche neuen Substanzen wie SGLT-2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptoragonisten nicht nur den Blutzucker senken, sondern auch kardiovaskuläre und nephroprotektive Effekte bieten.
Die partizipative Entscheidungsfindung zur Steigerung der Adhärenz in der leitliniengerechten Umsetzung der Therapieempfehlungen wird ebenso diskutiert wie die notwendige Umsetzung der Leitlinien besonders für Patienten mit einem langjährigen fortgeschrittenen Typ-2-Diabetes. Hier geht es um mögliche Therapiedeeskalationen – denn: Insulin ist keine Einbahnstraße. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich praxisnah mit den aktuellen Leitlinien vertraut zu machen, um Ihre therapeutische Entscheidungsfindung zu optimieren und Ihren Patienten eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten.





Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie
Leitender Oberarzt und W2 Professor für Gastrointestinale Onkologie, Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Endokrinologie, Medizinische Hochschule Hannover
Toronto General Hospital and UHN-Princess Margaret Cancer CentRE, Toronto, Canada
- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Pathologie
HER2+ biliäre Karzinome – Auf zu neuen Horizonten
HER2+ biliäre Karzinome – Auf zu neuen Horizonten
Biliäre Karzinome (biliary tract cancers, BTC) werden meist erst in einem fortgeschrittenen, nicht resektablen Stadium diagnostiziert und sind trotz moderner Systemtherapien weiterhin mit einer sehr ungünstigen Prognose verbunden.
Diese Fortbildung beleuchtet vor dem Hintergrund der aktuellen ESMO-Leitlinien die sich wandelnden Therapiestrategien bei fortgeschrittenen biliären Tumoren, insbesondere die wachsende Bedeutung der molekularen Diagnostik und des Biomarkers HER2: Von der Häufigkeit und prognostischen Relevanz von HER2-Alterationen über praxistaugliche Testverfahren, bis hin zu den klinischen Daten neuer HER2-gerichteter, chemotherapiefreier Behandlungsansätze in der Zweitlinie.
Teilnehmende lernen, Leitlinien-Updates für Erst- und Folgetherapien sicher einzuordnen, molekulare Profile inklusive HER2-Status frühzeitig und qualitätsgesichert anzufordern sowie Testergebnisse korrekt zu interpretieren und in praxistaugliche Therapiesequenzen zu überführen.





Niedergelassene HNO-Fachärztin,
Ehemalige Sektionsleitung Otologie und Neuro-Otologie am Universitätsklinikum Heidelberg
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Allgemeinmedizin / Geriatrie
Schwerhörigkeit im Alter: Was tun, wenn konventionelle Hörgeräte nicht mehr helfen?
Schwerhörigkeit im Alter: Was tun, wenn konventionelle Hörgeräte nicht mehr helfen?
Die steigende Lebenserwartung bringt eine zunehmende Zahl an Patienten mit Altersschwerhörigkeit (Presbyakusis) mit sich, bei denen konventionelle Hörgeräte manchmal an ihre technischen Grenzen stoßen. Diese Fortbildung informiert über Behandlungsmöglichkeiten, mit denen Sie eine optimale Versorgung Ihrer Patienten auch bei schweren Formen des Presbyakusis erreichen und ihnen eine hohe Lebensqualität unter bestmöglicher Einbeziehung des Hörsinns ermöglichen können. Erfahren sie in dieser folienbasierten eCME mehr über:
- Die klinische Manifestation der Altersschwerhörigkeit.
- Komorbiditäten und Folgen von unbehandelter Altersschwerhörigkeit.
- Versorgungsoptionen für unterschiedliche Ausprägungen von Altersschwerhörigkeit, von konventionellen Hörgeräten bis zur Versorgung mit Hörimplantatsystemen.
- Audiologische Kriterien, präoperative Diagnostik und postoperative Therapien bei der Versorgung mit Hörimplantatsystemen.





Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
- Kinder- und Jugendmedizin / Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin
Meningokokken B: STIKO-Empfehlung in Theorie und Praxis
Meningokokken B: STIKO-Empfehlung in Theorie und Praxis
Invasive Meningokokken-Erkrankungen (IME) gehören zu den schwerwiegendsten Infektionskrankheiten und stellen insbesondere für Säuglinge und Kleinkinder eine akute, potenziell lebensbedrohliche Situation dar. Charakteristisch sind schwere Verläufe bis hin zu einer Meningitis oder Sepsis.
Diese Fortbildung vermittelt Ihnen tiefgreifendes Wissen zur Epidemiologie und den Risikofaktoren von IME und bietet praxisnahe Einblicke in die aktuellen STIKO-Empfehlungen zur Meningokokken-B-Impfung. Sie erhalten wertvolle Hinweise, wie effektive Impfstrategien, Koadministration und Nachholimpfungen dazu beitragen können, Ihre Patienten frühzeitig vor einer IME zu schützen.



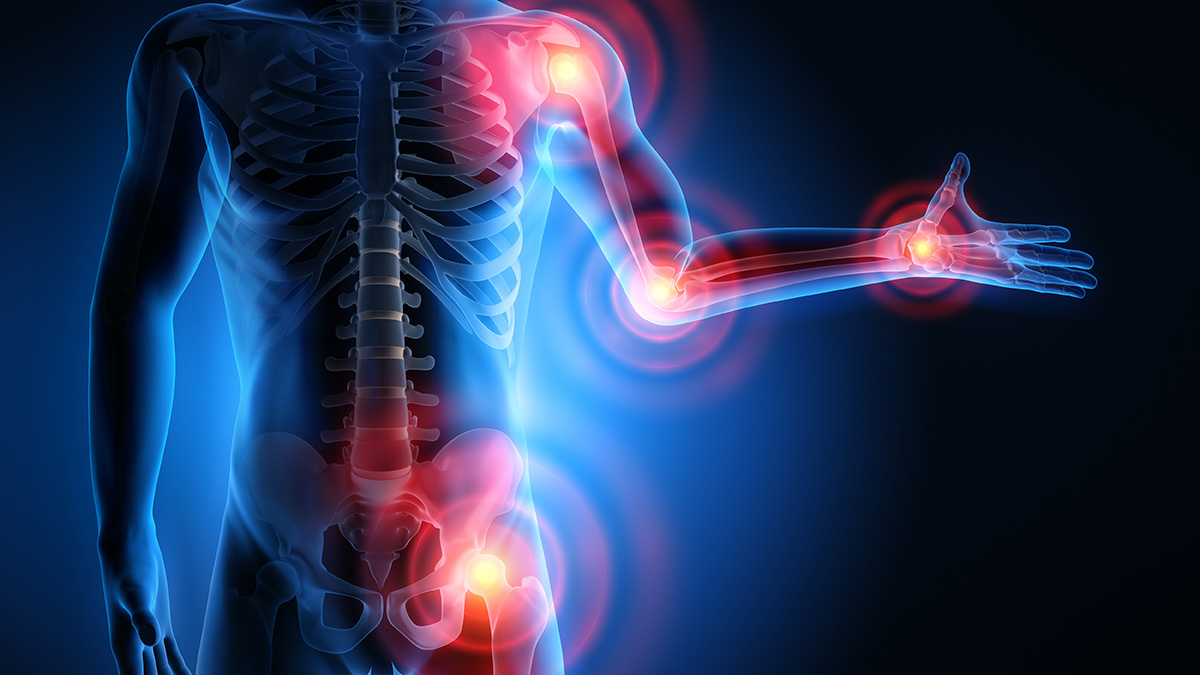

Facharzt für Innere Med. & Rheumatologie, Osteologe DVO, Oberarzt 1. Med. Abt., Boltzmann Institute für Osteologie, Hanusch Krankenhaus Wien
- Rheumatologie / Innere Medizin / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie / Allgemeinmedizin
Hypophosphatasie (HPP) als Differenzialdiagnose in der Rheumatologie
Hypophosphatasie (HPP) als Differenzialdiagnose in der Rheumatologie
Hypophosphatasie (HPP) ist eine seltene jedoch häufig übersehene Multisystemerkrankung mit erheblicher klinischer Relevanz in der Rheumatologie. Kennzeichen dieser Stoffwechselkrankheit ist eine persistierend niedrige Alkalische-Phosphatase-Aktivität. Diese Fortbildung beleuchtet die Bedeutung einer frühzeitigen Differenzialdiagnose, um Fehldiagnosen wie rheumatische Erkrankungen zu vermeiden. Sie gibt Einblicke in das breite Spektrum an HPP-Manifestationen im Erwachsenenalter sowie in die Diagnostik und den Krankheitsverlauf. Praxisrelevantes Wissen zur Abgrenzung von HPP gegenüber anderen Skelett- und Gelenkerkrankungen wird vermittelt, unterstützt durch aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und Fallbeispiele. Entdecken Sie, wie eine korrekte Diagnose HPP-Patienten eine gezielte und frühzeitige Betreuung ermöglicht.





Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen
- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Thromboembolien - Fokus auf Frauen und jüngere Personen
Thromboembolien - Fokus auf Frauen und jüngere Personen
Thromboembolische Erkrankungen zählen zu den häufigsten und potenziell lebensbedrohlichen internistischen Notfällen, deren Risiko auch bei jüngeren Menschen unterschätzt wird. Diese Fortbildung rückt bewusst Frauen und jüngere Patienten in den Mittelpunkt und zeigt, warum venöse Thromboembolien trotz niedriger Grundinzidenz in dieser Gruppe durch exogene Faktoren wie hormonelle Kontrazeption, Schwangerschaft/Wochenbett, Rauchen, Adipositas, Immobilisation auf Reisen oder Bewegungsmangel deutlich begünstigt werden können. Auf Basis aktueller Leitlinien werden klinische Warnzeichen und typische Präsentationen von TVT, LE und arteriellen Ereignissen geschärft, ebenso der strukturierte diagnostische Pfad über klinische Scores, D-Dimer und Bildgebung. Darüber hinaus beleuchtet die Fortbildung die leitliniengerechte Akuttherapie, die Phasen der Antikoagulation sowie nicht-medikamentöse Präventionsstrategien wie Kompression, Mobilisation und Risikoreduktion im Alltag.



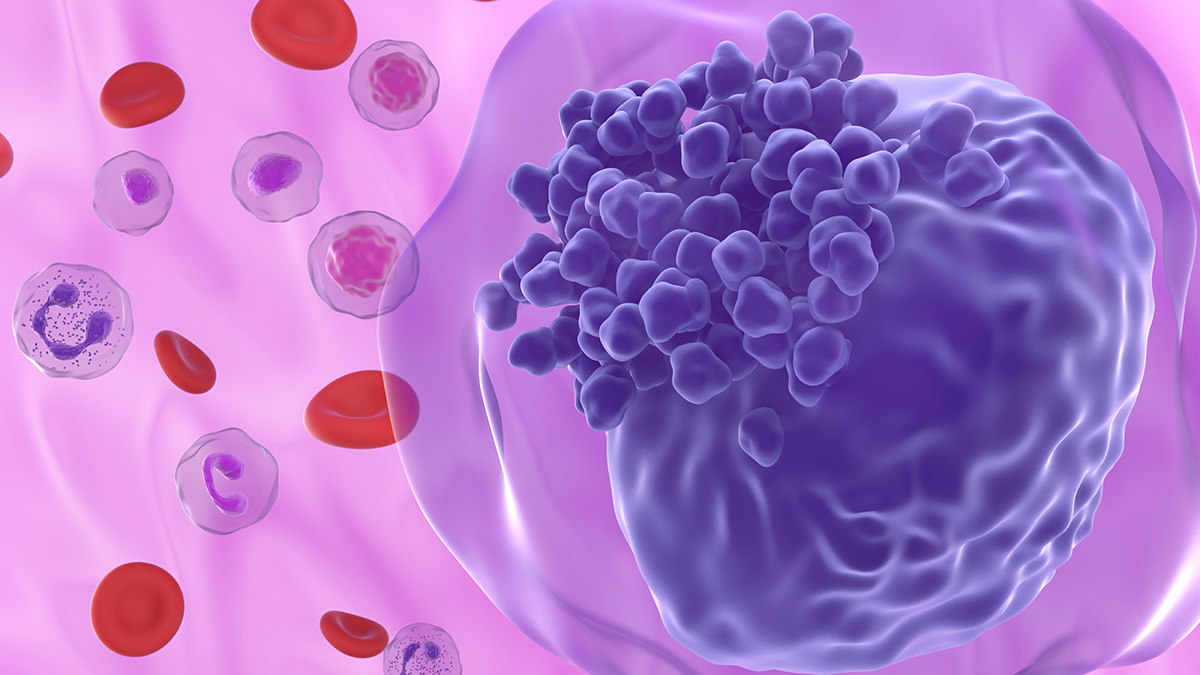

Oberarzt Klinik für Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie / Innere Medizin V
Taskforce-Leiter AML und MPN
Universitätsklinikum Heidelberg
- Hämatologie und Onkologie
Therapie der FLT3-mutierten AML fitter Patienten – Update der Onkopedia-Leitlinie
Therapie der FLT3-mutierten AML fitter Patienten – Update der Onkopedia-Leitlinie
Das aktuelle Onkopedia-Update bringt wichtige Veränderungen für die Therapie der FLT3-mutierten AML – insbesondere bei Patientinnen und Patienten, die für eine intensive Behandlung geeignet sind. Herr Dr. Sauer zeigt, wie sich die neuen Empfehlungen in der Erstlinientherapie und nach allogener Stammzelltransplantation sinnvoll umsetzen lassen und welche Bedeutung FLT3-bezogene MRD-Informationen künftig für therapeutische Entscheidungen haben. Die Fortbildung richtet sich an ein fachärztliches Publikum und bietet eine kompakte, differenzierte Orientierung für eine leitliniengerechte Versorgung dieser anspruchsvollen Patientengruppe.





Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie / Hypertensiologie DHL®
Nierenzentrum Wiesbaden
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Nephrologie / Kardiologie
Sicherer Umgang mit Hypertonie in der Hausarztpraxis - Was empfehlen die Leitlinien?
Sicherer Umgang mit Hypertonie in der Hausarztpraxis - Was empfehlen die Leitlinien?
Bluthochdruck ist nach wie vor die führende Todesursache weltweit – und häufig unzureichend kontrolliert. In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie sich die Empfehlungen der aktuellen Hypertonie-Leitlinien sinnvoll und praxisnah in den Alltag der Hausarztpraxis übertragen lassen.
Herr Prof. Vonend gibt Orientierung zu Zielwerten sowie zu medikamentösen und nicht-medikamentösen Maßnahmen und teilt seine Erfahrungen aus der klinischen Praxis. Er zeigt, worauf es in der praktischen Umsetzung wirklich ankommt – von der Diagnostik bis zum langfristigen Management –, um die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Hypertonie sicher, nachvollziehbar und wirksam zu gestalten.



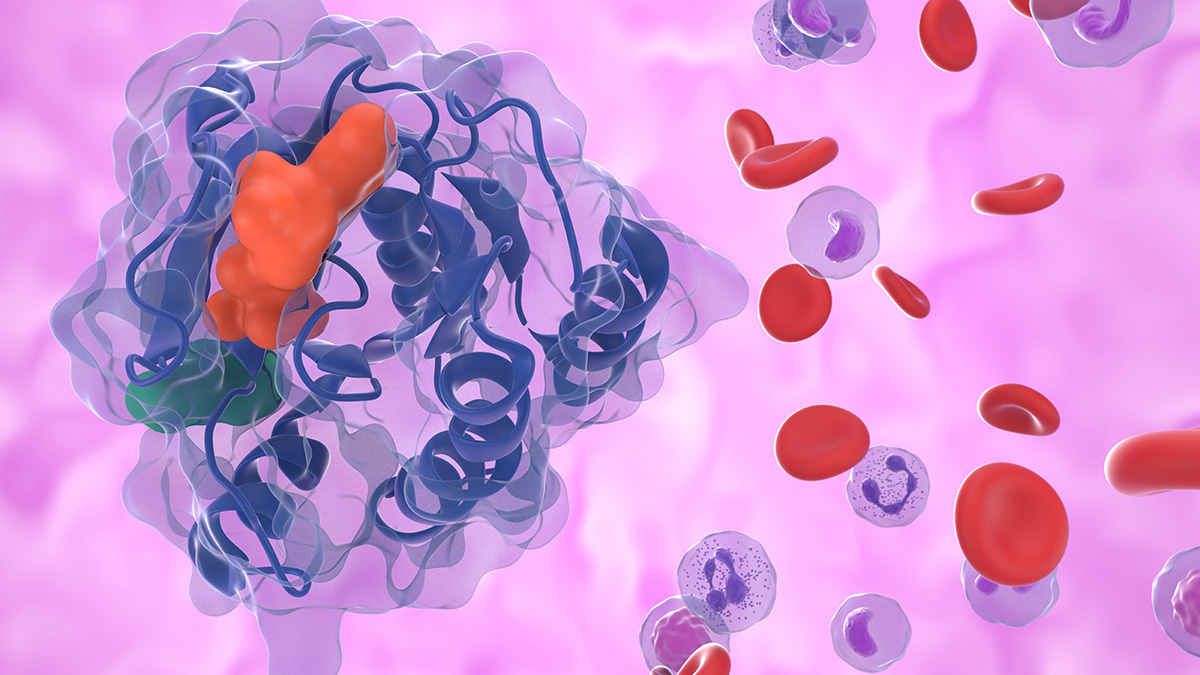

Fachärztin für Innere Medizin, Pneumologie, Medikamentöse Tumortherapie, Allergologie, Sozialmedizin
Senior Expert in der pneumologischen Onkologie am Universitätsklinikum Jena
- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie
Kombinierte genomische Veränderungen beim NSCLC
Kombinierte genomische Veränderungen beim NSCLC
Das nichtkleinzellige Lungenkarzinom (NSCLC) macht bis zu 85% aller Lungenkrebsdiagnosen aus und wird durch verschiedenste Genveränderungen verursacht. Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKI) und zielgerichtete Therapien können die Überlebenschancen von Patienten mit onkogenabhängigem NSCLC signifikant verbessern. Dabei können Co-Mutationen in oder Amplifikationen von Tumorsuppressoren und anderen Onkogenen wie TP53, STK11, KEAP1, PIK3CA und RB1 das Fortschreiten der Erkrankung, die Therapieresistenz und das klinische Outcome stark beeinflussen. Fortschritte beim Next-Generation Sequencing und molekularen Profiling haben die Identifizierung dieser Co-Mutationen ermöglicht und damit die Aussicht auf stärker personalisierte Therapieansätze eröffnet.





MHBA
Medizinische Klinik/Geriatrie
Chefärztin
SRH Klinikum Sigmaringen
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Gastroenterologie
Gastrointestinales Mikrobiom: Grundlagen
Gastrointestinales Mikrobiom: Grundlagen
Diese Fortbildung vermittelt die grundlegenden wissenschaftlichen Konzepte des gastrointestinalen Mikrobioms. Sie erläutert Zusammensetzung und Funktionen der Mikrobiota entlang des Verdauungstrakts, inklusive deren Bedeutung für Immunfunktion, Stoffwechsel, Darmbarriere und die bidirektionale Darm-Hirn-Achse. Zudem zeigt sie auf, wie Ernährung, Lebensstil und Medikamente das Mikrobiom beeinflussen, wie Dysbiosen entstehen und welche evidenzbasierten Möglichkeiten es gibt, das Mikrobiom gesund zu erhalten und therapeutisch zu modulieren.





Facharzt für Innere Medizin und Hämatogie und Onkologie,
Oberarzt, Klinik für Innere Medizin II,
Hämatologie und Internistische Onkologie,
Universitätsklinikum Jena
- Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie
Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024
Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine erworbene Thrombozytopenie, die durch eine Autoimmunreaktion gegen Thrombozyten und Megakaryozyten verursacht wird. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Dr. Stauch wertvolle Informationen zur Pathophysiologie, zum klinischen Bild, zur Diagnose sowie zu den aktuellen Therapieoptionen der ITP. Besonders im Fokus stehen die im August 2024 erschienene neue Leitlinie zur ITP sowie die Behandlung mit Kortikosteroiden. Die Steroidtherapie wird dabei samt leitliniengerechtem Einsatz, möglichen Nebenwirkungen wie Osteoporose, kardiovaskulären Komplikationen, Infektionen und Diabetes sowie Behandlungsrealität besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Expertise zu vertiefen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.





stellvertr. ärztlicher Direktor und Leiter des Instituts für Cardiomyopathien Heidelberg, Universitätsklinikum Heidelberg
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie / Nuklearmedizin
Kardiale Amyloidose: Verdacht und erste Schritte
Kardiale Amyloidose: Verdacht und erste Schritte
Bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die unter Luftnot, Schwindel sowie mangelnder Belastbarkeit leiden und nicht auf die Standardtherapie bei Herzinsuffizienz ansprechen, kann eine kardiale Amyloidose wie die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) zugrunde liegen. Insbesondere ältere Patient:innen sind davon betroffen und die Diagnose erfolgt häufig, aufgrund der Heterogenität der Symptome, sehr spät.
Im Fokus dieser Fortbildung stehen die Besonderheiten des Krankheitsbildes der kardialen Amyloidose. Ein interdisziplinäres Expertenteam diskutiert ihre Erfahrungen und verdeutlicht praxisnah die Vorgehensweise bei Verdacht einer kardialen Amyloidose bis hin zur Diagnose. Red Flags der ATTR-CM, wichtige Hinweise zur Differentialdiagnose und die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit werden vorgestellt und diskutiert. Zur Veranschaulichung der diagnostischen Elemente dienen Einspieler der teilnehmenden Fachärzte sowie ausgewählte Beiträge verschiedener Universitätszentren. Des Weiteren schildert ein betroffener Patient seine Krankengeschichte.





Facharzt für Allgemeinmedizin
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Kinder- und Jugendmedizin
Pneumokokken im Fokus: Aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven
Pneumokokken im Fokus: Aktuelle Lage und Zukunftsperspektiven
Die Pneumokokken sind weltweit verbreitet und besiedeln überwiegend asymptomatisch den Nasen-Rachen-Raum des Menschen. Eine akute Erkrankung entsteht, wenn es zu einer lokalen Ausbreitung des Erregers in den oberen (Sinusitis, Otitis media) oder unteren Atemwegen (Pneumonie) kommt. Besonders schwerwiegend sind die invasiven Pneumokokken-Erkrankungen (Meningitis, Sepsis), wobei Säuglinge und ältere Menschen das höchste Risiko für einen schweren Verlauf haben – daher ist ihr Schutz umso wichtiger.
Diese CME gibt Ihnen detaillierte Informationen zum Krankheitsbild, den aktuell verfügbaren Impfstoffen und der aktuellen STIKO-Empfehlung. Am Ende der Fortbildung wird einen Blick auf neue Impfstofftechnologien und in die Zukunft der Pneumokokken-Impfstoffe geworfen.





MHBA
Leitender Arzt, Zentrale Notaufnahme
GFO Kliniken Rhein-Berg
Betriebsstätte Marien-Krankenhaus
- Anästhesiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin / Intensivmedizin
Analgesie 360°: Akutschmerztherapie, chronische Schmerzen und regionale Verfahren in der Notaufnahme
Analgesie 360°: Akutschmerztherapie, chronische Schmerzen und regionale Verfahren in der Notaufnahme
Akute und chronische Schmerzen zählen zu den häufigsten Herausforderungen in der Notaufnahme und erfordern ein strukturiertes, patientenorientiertes Vorgehen. Diese Fortbildung gibt einen kompakten Überblick über moderne Akutschmerztherapie, den Umgang mit chronischen Schmerzpatienten sowie den sicheren Einsatz regionaler Verfahren und zeigt anhand praxisnaher Beispiele, wie multimodale Strategien, alternative Applikationswege (wie z.B. Lachgas) eine schnelle und effektive Schmerzlinderung ermöglichen.
Teilnehmende Ärztinnen und Ärzte erfahren, wie Schmerz sicher eingeschätzt und differenziert behandelt wird, wie Opioide verantwortungsvoll eingesetzt und angepasst werden und welche Rolle nichtmedikamentöse Maßnahmen und Regionalanästhesien im Notfall spielen.