Aktuelle CME
Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.





Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Oberärztin, Leitung CRC, Unterrichtsbeauftragte,
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
Hereditäres Angioödem - Krankheitsbild und Therapie
Hereditäres Angioödem - Krankheitsbild und Therapie
Das hereditäre Angioödem (HAE) ist eine seltene genetische Erkrankung, die durch wiederkehrende und unvorhersehbare Angioödem-Attacken gekennzeichnet ist. Diese können verschiedene Körpersysteme - von Haut und Gastrointestinaltrakt bis hin zu lebensbedrohlichen laryngealen Ödemen - betreffen und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich einschränken.
Diese Fortbildung vermittelt Ihnen fundierte Einblicke in die Pathophysiologie des HAE, diagnostische Ansätze sowie innovative Strategien zur Akut- und Langzeittherapie. Ein praxisnaher Patientenfall veranschaulicht die individuellen Behandlungsoptionen. Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen zu helfen, HAE frühzeitig zu erkennen, individuell angepasste Therapiepläne zu entwickeln und gemeinsam mit den Patienten nachhaltige Therapieziele zu definieren.



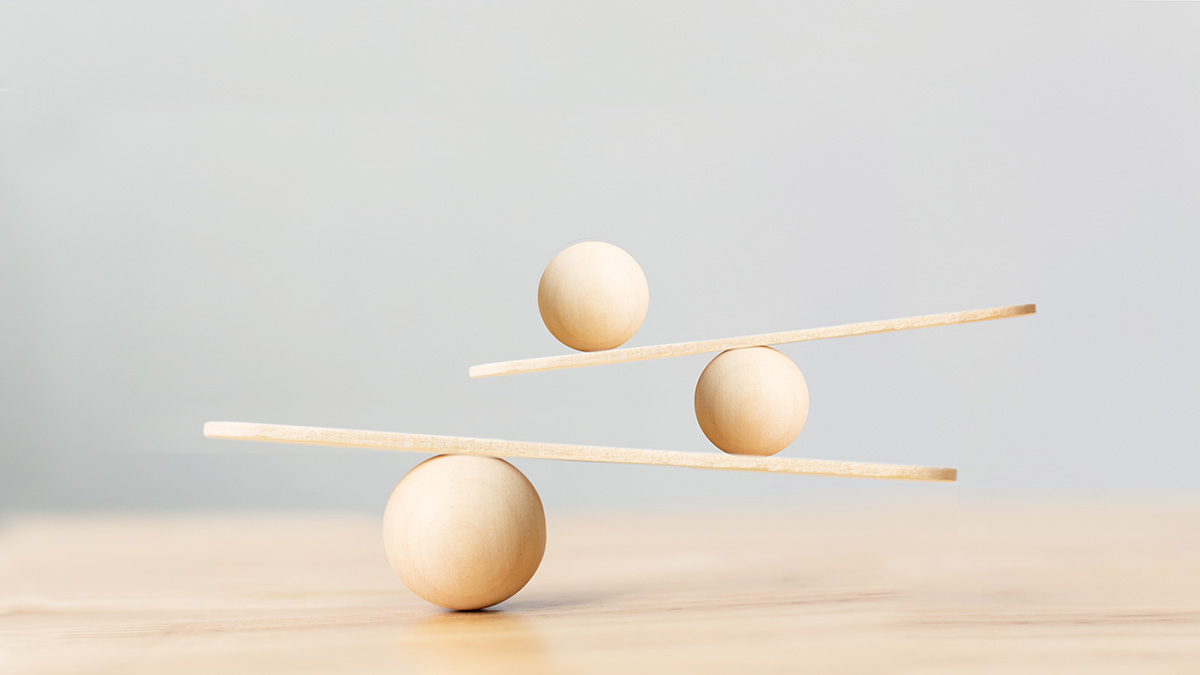

Stellvertretende Klinikdirektorin und Sektionsleitung Stammzelltransplantation, Klinik für Innere Medizin II, Abteilung für Hämatologie und Internistische Onkologie, Universitätsklinikum Jena
- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Graft-versus-Host Disease (GvHD): Langzeitfolgen und Lebensqualität
Graft-versus-Host Disease (GvHD): Langzeitfolgen und Lebensqualität
Die Graft-versus-Host-Erkrankung (GvHD) ist eine Multisystemerkrankung, die bei ca. 50 % der Patienten nach einer allogenen Blutstammzelltransplantation auftritt. Die chronische GvHD kann nahezu jedes Organsystem betreffen und kann mit einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit und Lebensqualität einhergehen. Erhalten Sie in dieser CME wertvolle Informationen sowohl zu physischen und psychischen Langzeitfolgen wie Fatigue, Infektionsneigung, Depression und Angst als auch zu sozialen Langzeitfolgen. Erfahren Sie mehr über die Supportivtherapie von cGvHD-Patienten, die neben dem organspezifischen Symptommanagement und der Prävention von Infektionen auch ein Monitoring von Krankheitslast, psychischem Distress und Lebensqualität beinhalten sollte.





Facharzt für Innere Medizin und Angiologie,
Phlebologie, Diabetologie, Hämostaseologie
CCB Gefäß Centrum
- Kardiologie / Angiologie / Innere Medizin
Therapie und Sekundärprophylaxe venöser Thromboembolien mit direkten oralen Antikoagulanzien bei Erwachsenen mit Adipositas
Therapie und Sekundärprophylaxe venöser Thromboembolien mit direkten oralen Antikoagulanzien bei Erwachsenen mit Adipositas
Übergewicht und Adipositas erhöhen das Risiko für venöse Thromboembolien (VTE). Bis 2035 könnten weltweit über 4 Milliarden Menschen von Übergewicht oder Adipositas betroffen sein, im Vergleich zu 2,6 Milliarden im Jahr 2020.
Diese zertifizierte Fortbildung behandelt den Einfluss von Adipositas auf das VTE-Risiko. Sie analysiert die VTE-Therapie mit direkten oralen Antikoagulanzien (DOAK) bei erwachsenen Patient:innen mit Adipositas unter Berücksichtigung aktueller Studiendaten und Leitlinienempfehlungen sowie therapeutischer Entwicklungen in der Adipositas-Therapie.





Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Suchtmedizin, Clinical Assistant Professor, University of Florida, Chefärztin, Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie – Psychosomatik
Klinikum Frankfurt Höchst
- Allgemeinmedizin / Psychiatrie und Psychotherapie
Psychoaktive Stoffe - Neue Einsatzgebiete in der Psychiatrie
Psychoaktive Stoffe - Neue Einsatzgebiete in der Psychiatrie
Psychoaktive Substanzen beeinflussen das zentrale Nervensystem und haben das Potenzial, das Behandlungsspektrum psychischer Erkrankungen zu erweitern. Lange Zeit aufgrund ihrer Missbrauchsgefahr stigmatisiert, erleben einige dieser Substanzen – darunter klassische Psychedelika – eine Renaissance in der medizinischen Forschung. Insbesondere in der psycholytischen Therapie zeigen sich vielversprechende Ergebnisse bei therapieresistenten Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen.
Diese Fortbildung bietet eine fundierte Übersicht über den aktuellen wissenschaftlichen Stand zur therapeutischen Anwendung psychoaktiver Substanzen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich mit einem innovativen, aber anspruchsvollen Therapieansatz vertraut zu machen, der in Zukunft eine größere Rolle in der Psychiatrie spielen könnte.
Gleichzeitig sind neue psychoaktive Substanzen (NPS) eine wachsende Herausforderung für die Medizin, da sie häufig unkontrolliert konsumiert werden und mit erheblichen Gesundheitsrisiken verbunden sind. Ihre chemische Variabilität erschwert die Regulierung und stellt Ärzte vor diagnostische und therapeutische Schwierigkeiten – insbesondere in Notfallsituationen. Ein Verständnis dieser Substanzen ist essenziell, um sowohl deren therapeutisches Potenzial als auch die Risiken des Missbrauchs richtig einzuordnen.





Praktischer Arzt
- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin
Erhöhter TSH-Wert und Schilddrüsenerkrankungen in der Hausarztpraxis - Neue Leitlinie 2023
Erhöhter TSH-Wert und Schilddrüsenerkrankungen in der Hausarztpraxis - Neue Leitlinie 2023
Ein erhöhter TSH-Wert kann auftreten, wenn die Hypophyse vermehrt aktiv ist, um möglicherweise eine latente oder manifeste Schilddrüsenunterfunktion (Hypothyreose) auszugleichen. In der aktuellen S2k-Leitlinie 2023 wird ein erhöhter TSH-Wert erstmals in Abhängigkeit vom Alter interpretiert. Die aktuelle Leitlinie zum erhöhten TSH-Wert in der Hausarztpraxis wird im Rahmen dieser Fortbildung besprochen und Sie erfahren das Wichtigste zur Diagnostik samt TSH-Screening, Anamnese, körperliche Untersuchung, Diagnosesicherung sowie weiterführender Diagnostik und erhalten wertvolle Informationen zu möglichen Einflussfaktoren auf die TSH-Messung sowie zur Bewertung der TSH-Werte. Darüber hinaus wird die Therapie samt Therapieindikationen allgemein, bei latenter Hypothyreose und bei älteren Patienten besprochen sowie auf die TSH-Verlaufskontrolle und auf Reduktions- bzw. Auslassversuche eingegangen. Algorithmen zum diagnostischen und therapeutischen Vorgehen sowie wichtige Empfehlungen zum TSH-Wert in der Schwangerschaft runden diese Fortbildung ab.





Oberarzt
Leitung Klassische Hämatologie und Hämostaseologie
Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation
Westdeutsches Tumorzentrum Essen
Universitätsmedizin Essen (AöR)
- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie
Diagnostik und Therapie der Kälteagglutininerkrankung (CAD)
Diagnostik und Therapie der Kälteagglutininerkrankung (CAD)
Die Kälteagglutininerkrankung (CAD) ist eine selten Autoimmunerkrankung, der eine lymphoproliferative B-Zell-Erkrankung zugrunde liegt. Diese Fortbildung bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie der CAD, mit besonderem Fokus auf aktuelle und innovative Behandlungsansätze. Herr Professor Röth erläutert sowohl die B-Zell-gerichtete Immunchemotherapie als auch die Komplementinhibition als zentrale Therapiestrategien und stellt vielversprechende neue Behandlungsmöglichkeiten vor.
Teilnehmende Ärzte erhalten praxisnahe Einblicke in die sicheren Diagnosekriterien, die individuelle Therapieauswahl und die Integration moderner Therapiekonzepte in den klinischen Alltag.





Facharzt für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie,
Facharzt für Laboratoriumsmedizin,
Chefarzt, Abteilung für Labormedizin, Impfzentrum,
Klinikum Würzburg Mitte, Standort Juliusspital
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Infektiologie
Dengue - auch in Europa ein wachsendes Gesundheitsproblem?
Dengue - auch in Europa ein wachsendes Gesundheitsproblem?
Dengue ist die weltweit häufigste arbovirale Virusinfektion mit steigenden Fallzahlen, die sich aufgrund von Klimawandel, Urbanisierung und globalem Reiseverkehr zunehmend weiter ausbreitet. Auch in Europa werden immer häufiger autochthone und reiseassoziierte Fälle gemeldet. Im Rahmen dieser Fortbildung vermittelt Prof. Dr. Tino F. Schwarz aus Würzburg fundiertes Basiswissen zu Dengue und geht dabei unter anderem auf die Epidemiologie, die Diagnostik, die klinische Präsentation und die Herausforderungen dieser Erkrankung ein. Darüber hinaus werden praxisnahe Empfehlungen zur Prävention von Dengue samt wertvollem Überblick zu den zugelassenen und in der Entwicklung befindlichen Impfstoffen gegeben. Aktuelle Entwicklungen zu Dengue in Europa und die Bedeutung für die klinische Praxis stehen im Fokus. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zu vertiefen und Ihre Patienten bestmöglich vor den Risiken von Dengue zu schützen.





Leitende Ärztin und Stv. Chefärztin Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Endokrinologie und Diabetologie
Wechseljahre im Dialog: vom Patientinnenwunsch zur informierten Entscheidung in der Wechseljahrestherapie
Wechseljahre im Dialog: vom Patientinnenwunsch zur informierten Entscheidung in der Wechseljahrestherapie
Die Wechseljahre sind eine bedeutende Phase im Leben einer Frau, begleitet von hormonellen Veränderungen, die zu vielfältigen Beschwerden führen können. Frau Prof. Stute bietet Ihnen in dieser Fortbildung einen fundierten Überblick über die Diagnostik, die hormonellen und nicht-hormonellen Therapieoptionen sowie die personalisierte Beratung zu und die Behandlung von Wechseljahresbeschwerden. Ein besonderer Fokus liegt auf der individuellen gemeinsamen Entscheidungsfindung von Ärzt*in und Patientin, der Nutzen-Risiko-Abwägung und den aktuellen Leitlinienempfehlungen. Abschließend nimmt Frau Prof. Stute Sie mit auf die spannende Reise einer außergewöhnlichen Patientin durch die verschiedenen Phasen der Wechseljahre und gibt wertvolle, praxisnahe Tipps für die optimale Betreuung.
Diese Fortbildung soll Ihr Wissen über die präzise Diagnostik, die maßgeschneiderte Therapieplanung und die Wichtigkeit eines interdisziplinären Behandlungsansatzes erweitern und vertiefen.





Interventioneller Kardiologe mit dem Schwerpunkt Bildgebung sowie Leiter des kardiologischen Hochschulambulanz-Zentrums am Universitätsklinikum Augsburg
- Angiologie / Kardiologie / Radiologie
Koronare Bildgebung
Koronare Bildgebung
Anhand eines klinischen Patientenfalles mit Verdacht auf Perimyokarditis führt Herr PD Dr. Bittner in das Thema dieser Fortbildung, die koronare Bildgebung, ein. Nach einem Einblick in die Pathohistologie, insbesondere in die Atherom Klassifikation, wird im Folgenden der Fokus auf die invasive und nicht-invasive Diagnostik gelegt. Mit Hilfe von Bildbeispielen werden die unterschiedlichen bildgebenden Verfahren wie IVUS, NIRS, OCT sowie die koronare CT-Angiographie vorgestellt und ihre Bedeutung für die Diagnostik der koronaren Herzerkrankung näher beleuchtet. Verschiedene Therapiestrategien werden am Ende des Vortrags präsentiert und der Einfluss medikamentöser Wirkstoffe auf kardiovaskuläre Ereignisse, Plaque-Volumen und Plaque-Morphologie betrachtet.





Praxis für Naturheilverfahren, Bad Camberg
Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Sportmedizin, Notfallmedizin, Ernährungsmediziner
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Psychiatrie und Psychotherapie / Kardiologie
Evidenzbasierte Phytotherapie für die Praxis - Pflanzliche Arzneimittel für Herz, Hirn und Darm
Evidenzbasierte Phytotherapie für die Praxis - Pflanzliche Arzneimittel für Herz, Hirn und Darm
Natürliche Heilmittel sind bei der deutschen Bevölkerung beliebt: Laut einer repräsentativen Umfrage bevorzugen 80,9 % sie zur Behandlung von leichteren Erkrankungen. Vor diesem Hintergrund wurde die Fortbildung „Evidenzbasierte Phytotherapie für die Praxis – Pflanzliche Arzneimittel für Herz, Hirn und Darm“ entwickelt. In dieser Fortbildung stellen die Experten Prof. Dr. med. Tillmann Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover und Prof. Dr. med. Peter W. Gündling von der Carl Remigius Medical School Idstein evidenzbasierte Phytopharmaka als verträgliche Alternative zu chemisch-synthetischen Arzneimitteln vor. Sie beleuchten die verschiedenen Anwendungsgebiete pflanzlicher Arzneimittel, definieren Qualitäts-, Wirksamkeits- und Verträglichkeitsanforderungen und erörtern die Unterschiede zwischen verschiedenen Extraktionsmethoden sowie weitere wichtige Einflussfaktoren bei der Behandlung.



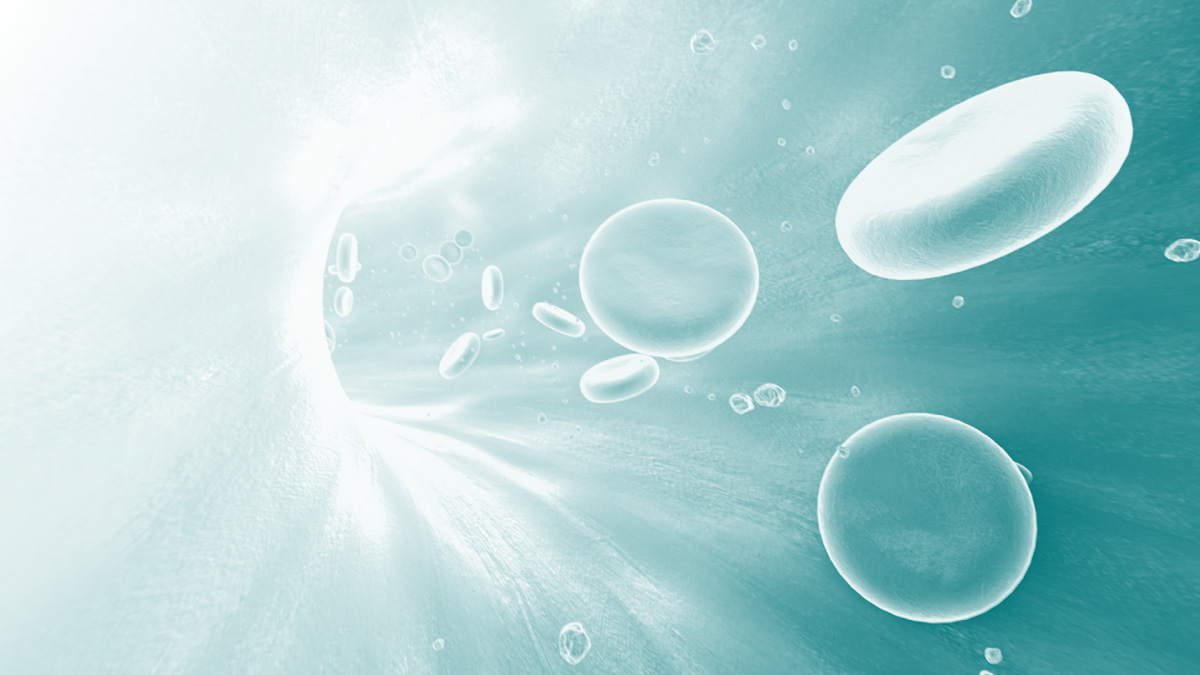

Klinik für Innere Medizin I, Schwerpunkt: Hämatologie, Onkologie und Stammzelltransplantation
Universitätsklinikum Freiburg
- Hämatologie und Onkologie
Aktueller Stand der Diagnostik und Therapie Myeloproliferativer Neoplasien (MPN)
Aktueller Stand der Diagnostik und Therapie Myeloproliferativer Neoplasien (MPN)
Diese Fortbildung bietet einen umfassenden Überblick über die Diagnostik und Therapie myeloproliferativer Neoplasien (MPN). Behandelt werden Krankheitsentitäten wie essentielle Thrombozythämie, Polycythaemia Vera und primäre Myelofibrose, deren Symptome, diagnostische Herausforderungen sowie aktuelle und neue Therapieoptionen.





Praktischer Arzt
- Allgemeinmedizin
Vegetarische / Vegane Ernährung - Neu bewertete Empfehlungen der DGE
Vegetarische / Vegane Ernährung - Neu bewertete Empfehlungen der DGE
Die Zahl der Menschen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, ist in den letzten Jahren gestiegen. Wie wirkt sich dies auf die Gesundheit aus und welche Herausforderungen ergeben sich dadurch für die ärztliche Praxis? Diese Fortbildung beleuchtet die aktuellen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) und vermittelt praxisnahe Strategien zur Erkennung und Prävention möglicher Nährstoffmängel bei einer vegetarischen bzw. veganen Ernährung. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den potenziell kritischen Nährstoffen. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Informationen zu den Vor- und Nachteilen einer vegetarischen bzw. veganen Ernährung und zu den Empfehlungen der DGE für Kinder, Jugendliche, Schwangere, Stillende und Senioren. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Patienten kompetent zu begleiten und die gesundheitlichen Chancen einer gut geplanten vegetarischen oder veganen Ernährung optimal auszuschöpfen.



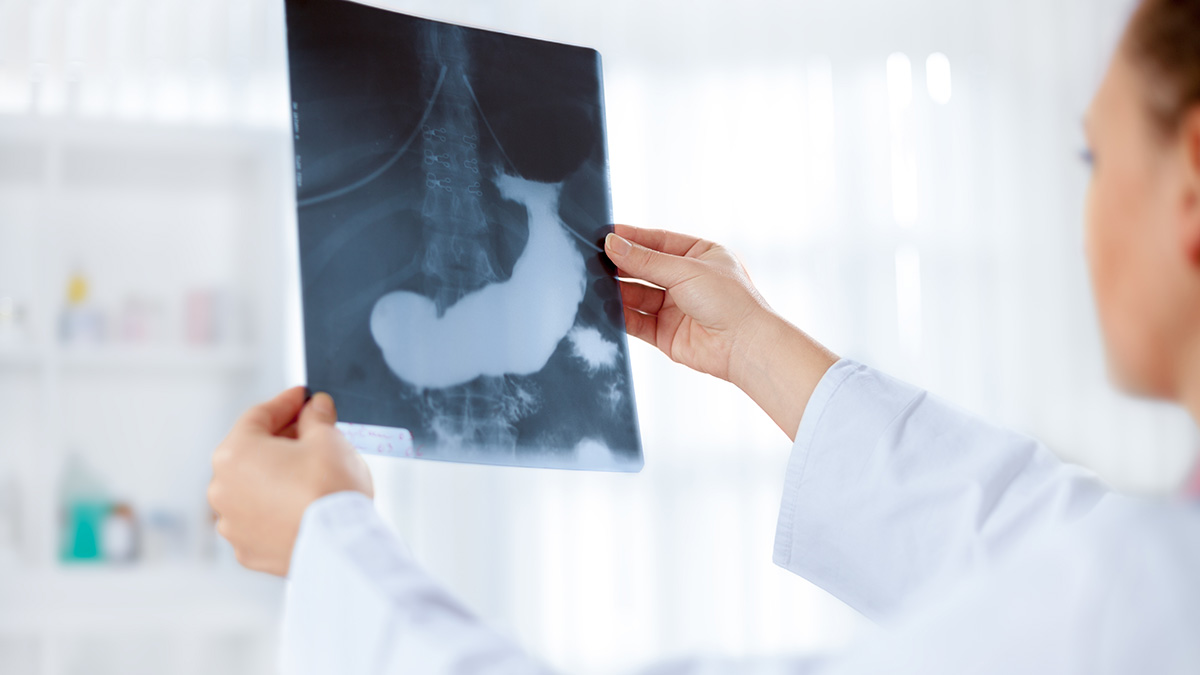

Leiterin Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie Universitätsklinikum Erlangen,
Professorin für Endokrinologie (W3)
Bereichsleitung Neuroendokrine Tumore (NET)
- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Nuklearmedizin / Innere Medizin
Aktuelle ENETS Leitlinie NET des Pankreas: Was ist neu in Klinik und Praxis?
Aktuelle ENETS Leitlinie NET des Pankreas: Was ist neu in Klinik und Praxis?
Neuroendokrine Tumoren im Pankreas (Pan-NET) haben meist eine schlechte Prognose. Die Mehrzahl der Tumoren sind zum Diagnosezeitpunkt bereits fortgeschritten. Die Prävalenz liegt bei 1-5 pro 10.000, so dass, trotz der geringen Häufigkeit, es wahrscheinlich ist, dass Ihnen der eine oder andere Fall in der Praxis begegnen wird.
Erfahren Sie in dieser CME, warum das Leitlinien-Update der European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) zu Pankreas-NET bedeutsam ist, und welche Änderungen eingeflossen sind. Die Referentinnen gehen anhand von 10 Schlüsselfragen aus der Leitlinie auf die einzelnen Diagnoseverfahren und möglichen Therapieoptionen ein. Profitieren Sie von dem Expertenwissen von Frau Prof. Pavel und Frau Prof. Rinke, die zu den einzelnen Abschnitten stets den Bezug zur Praxis suchen und in den Austausch gehen. Die Einbindung von Kasuistiken rundet diese Fortbildung ab.





Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Nervenheilkunde, Geriatrie, Geschäftsführender Oberarzt, Leitung des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Sexualmedizin, Medizinische Hochschule Hannover
- Allgemeinmedizin / Naturheilverfahren / Psychiatrie und Psychotherapie
Innere Unruhe und subsyndromale Angst: Bagatelle oder behandlungsbedürftig
Innere Unruhe und subsyndromale Angst: Bagatelle oder behandlungsbedürftig
Mit 17 Prozent ist das Lebenszeitrisiko für Angsterkrankungen und innere Unruhe hoch. Frauen sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Männer. Gleichzeitig sind psychische Erkrankungen unter den Top 10 der am meisten belastenden Erkrankungen und beeinträchtigen die Lebensqualität enorm. Deshalb ist es auch gerade in der Primärversorgung wichtig, diese Patienten zu erkennen und zu beraten.
Im Rahmen dieser Fortbildung erläutert Prof. Tillmann Krüger von der Medizinischen Hochschule Hannover die verschiedenen Krankheitsbilder im Zusammenhang mit Ängsten und Unruhe. Zudem werden Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt und die Bedeutung pflanzlicher Arzneimittel diskutiert.





Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie
Internistenzentrum MVZ Gauting-Starnberg
- Allgemeinmedizin
Histaminintoleranz - Das Wichtigste zu Ursachen, Diagnostik und Therapie
Histaminintoleranz - Das Wichtigste zu Ursachen, Diagnostik und Therapie
Die Histaminintoleranz ist eine anerkannte und in Leitlinien erfasste Erkrankung. Diese beschreibt nach aktuellem Verständnis, dass Patienten das mit der Nahrung aufgenommene Histamin nicht ausreichend abbauen können. Dadurch gelangt vermehrt Histamin in den Blutkreislauf, wodurch Symptome entstehen können. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Martin Storr das Wichtigste zu den Ursachen, zur Diagnostik und zur Therapie einer Histaminintoleranz. Dabei werden neben wertvollen Informationen zum Histamin, zur Pathophysiologie und zur Klassifikation der Erkrankung auch die häufigsten Symptome sowie die Diagnose in der primärärztlichen Versorgung vorgestellt. Darüber hinaus wird die Therapie einer gesicherten Histaminintoleranz diskutiert, die sowohl die Basistherapie samt einer histaminarmen Ernährung als auch eine spezielle Therapie samt Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln und sonstigen Maßnahmen wie Histamin-bindende mineralische Produkte beinhaltet. Praktische Tipps für Ihren Praxisalltag inklusive Auflistungen histaminreicher und -armer Lebensmittel runden diese Fortbildung ab.





Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen
- Kinder- und Jugendmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin
Typ-1-Diabetes - Gamechanger Pubertät
Typ-1-Diabetes - Gamechanger Pubertät
Typ-1-Diabetes stellt besonders in der Pubertät eine große Herausforderung dar: Hormonelle Veränderungen führen zu Schwankungen der Insulinempfindlichkeit, die eine flexible Anpassung der Therapie erfordern. Während Jungen durch das Wachstumshormon höhere Insulindosen benötigen, beeinflussen bei Mädchen zusätzlich der Menstruationszyklus und hormonelle Verhütungsmittel den Glucosestoffwechsel.
Die Fortbildung vermittelt praxisnah, wie Ärzte Jugendliche optimal begleiten, Therapieentscheidungen individuell anpassen und Adhärenz fördern können. Besonders für Frauenärzte und Kinderärzte ist dieser Beitrag relevant, da er wertvolle Einblicke in die geschlechtsspezifischen Besonderheiten des Diabetesmanagements gibt – von der Menarche bis zur Familienplanung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Kenntnisse über moderne Therapieansätze zu vertiefen und Ihre jungen Patientinnen bestmöglich zu unterstützen!





Leiter des Universitären Kinderwunschzentrums Kiel, Fachbereichsleitung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft
Wirkung und Funktion von Progesteron in der Schwangerschaft
Progesteron ist der hormonelle Dreh- und Angelpunkt für die Entstehung und den Erhalt einer Schwangerschaft. Damit eine Frau schwanger werden kann und auch schwanger bleibt, muss das Hormon ausreichend lange in einer genügend hohen Konzentration vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, ist die Schwangerschaft gefährdet, es drohen Früh- oder Fehlgeburt. Pro Jahr gibt es beispielsweise ca. 60.000 Frühgeburten allein in Deutschland. Das Thema Früh- und Fehlgeburt ist also allgegenwärtig.
In dieser Fortbildung präsentiert Herr PD Dr. med. Sören von Otte, Leiter des universitären Kinderwunschzentrums in Kiel, wichtiges Hintergrundwissen zu Funktion und Wirkung von Progesteron im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft. Zudem werden die aktuellen Leitlinien zu Frühgeburtsprophylaxe und Abortprophylaxe vorgestellt.



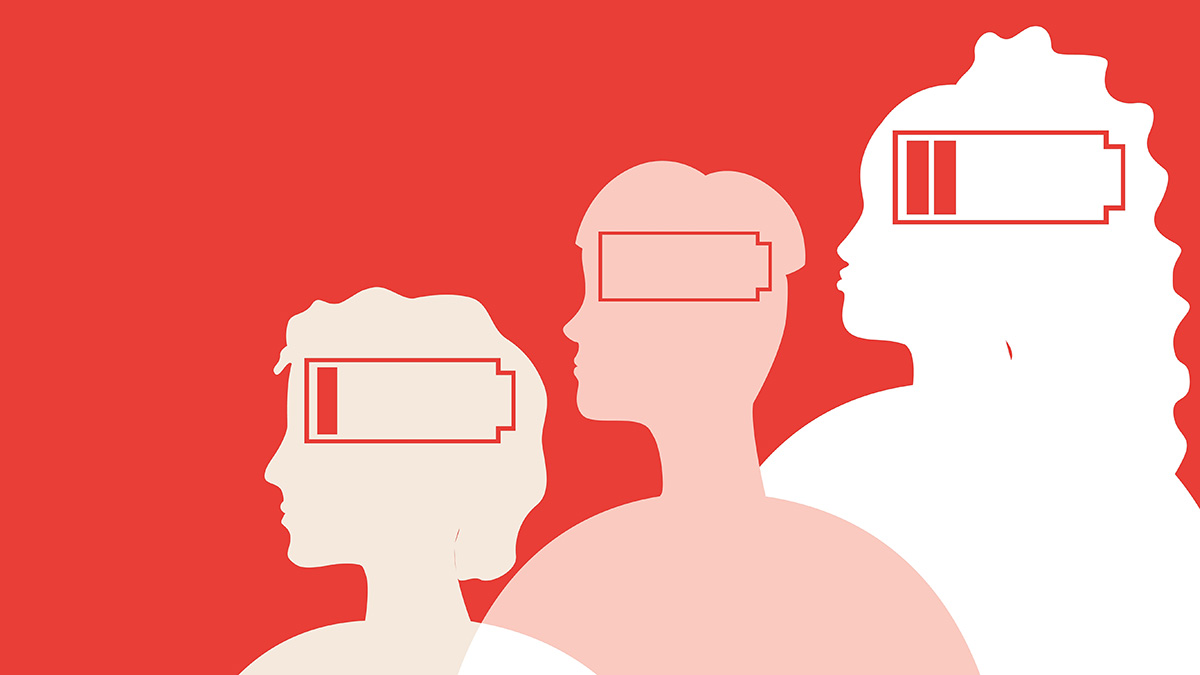

Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT
- Allgemeinmedizin
Burnout im Praxisteam vermeiden
Burnout im Praxisteam vermeiden
Ein Schlüssel zu einer exzellenten Patientenversorgung liegt im Wohlbefinden des Praxisteams. Diese Fortbildung zeigt, wie es gelingt, ein gesundes Arbeitsumfeld zu schaffen und die psychische Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter zu stärken. Dies trägt dazu bei, Fehlern und langen Ausfallzeiten vorzubeugen und die Sicherheit und Zufriedenheit der Patienten zu erhöhen. Mit Hilfe arbeits- und organisationspsychologischer sowie betriebswirtschaftlicher Ansätze wird die Gesundheit des Teams gezielt gefördert und gleichzeitig die Effizienz der Praxis gesteigert. Eine gesunde Arbeitswelt und ein attraktiver Arbeitsplatz sind mehr als nur Benefits - sie sind effektive Maßnahmen für eine optimale Versorgung.