CME Archiv





Facharzt für Kinderheilkunde- und Jugendmedizin (Pädiatrie)
Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und Neonatologie, Medizinische Hochschule Hannover
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Kinder- und Jugendmedizin
Invasive Meningokokken-Erkrankungen: Prävention durch Impfung
Invasive Meningokokken-Erkrankungen: Prävention durch Impfung
Invasive Meningokokken-Erkrankungen (IME) werden durch Bakterien der Art Neisseria meningitidis (Meningokokken) verursacht. Bei ca. 10 % der Bevölkerung ist eine Besiedlung der Schleimhäute im Nasen-Rachen-Raum mit Meningokokken nachweisbar, ohne dass diese Personen klinische Symptome aufweisen (asymptomatische Träger). Die Trägerrate kann abhängig von Land und Alter jedoch auch höher ausfallen. So weisen in Europa Jugendliche und junge Erwachsene die höchste Trägerrate auf, mit einer Rate von bis zu 24 % bei den 19-Jährigen. In seltenen Fällen führt eine Besiedlung dazu, dass die Bakterien ins Blut übergehen. Diese invasiven Erkrankungen sind zwar selten, verlaufen dann jedoch fast immer schwer und können lebensbedrohlich sein.
Diese Fortbildung befasst sich zunächst mit dem Erreger sowie dessen Vorkommen, geht in einem weiteren Schritt auf die Epidemiologie weltweit, in Europa und Deutschland ein und informiert über das Krankheitsbild sowie betroffene Risikogruppen. Zum Abschluss werden die derzeit verfügbaren Impfstoffe und die aktuellen Impfempfehlungen vorgestellt.





Gyn. Onkologie & Palliativmedizin
Völklingen
- Hämatologie und Onkologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Intensivmedizin
Palliativmedizin in der praktischen Umsetzung
Palliativmedizin in der praktischen Umsetzung
In dieser eCME führt Sie Dr. med. Joachim Wagner in die Palliativmedizin und die damit verbundenen Behandlung- und Betreuungsmöglichkeiten ein. Sie erhalten einen Einblick in die Schmerzlinderung sowie Symptomkontrolle u.a. bei Fatigue, Atemnot, Delir und Todesrasseln sowie einen Überblick über die hierfür zur Verfügung stehenden Schmerzmittel und deren Besonderheiten bzw. Nebenwirkungen. Darüber hinaus werden auch der Umgang mit Depressionen und Angst am Lebensende sowie der Todeswunsch und Sterbehilfe näher beleuchtet.





Oberärztin, Fachärztin für Chirurgie
Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSEGi), Abt. Kinderneurologie, Sozialpädiatrie u. Epileptologie, Zentrum für Kinderheilkunde u. Jugendmedizin, Universitätsklinikum Gießen
- Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie / Kinder- und Jugendmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Rheumatologie / Innere Medizin
Hypophosphatasie (HPP) - Erkrankung, Diagnostik und Therapieoptionen
Hypophosphatasie (HPP) - Erkrankung, Diagnostik und Therapieoptionen
Die Hypophosphatasie (HPP) ist eine erbliche, systemische, progressive und potentiell lebensbedrohliche Stoffwechselstörung, die auf eine genetisch bedingte mangelnde Aktivität des Enzyms alkalische Phosphatase (AP) zurückzuführen ist. Dieser Mangel führt zu einer beeinträchtigten Knochenmineralisierung sowie einer Vielzahl von weiteren Symptomen, welche je nach Alter unterschiedlich ausgeprägt sein können. Diese eCME soll Sie in das facettenreiche Krankheitsbild der Hypophosphatasie einführen und Ihnen Kenntnisse zur Diagnostik und Therapie vermitteln. Sie erhalten zunächst einen umfassenden Einblick in die Ursachen und klinischen Manifestationen der HPP - mit Darstellung der pathophysiologischen und symptomatischen Aspekte der Erkrankung. Anschließend werden die wichtigsten Möglichkeiten und Kriterien bei der Diagnose der HPP vorgestellt und die zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten sowie Behandlungsziele behandelt und näher beleuchtet. Neben den kindlichen Formen der Erkrankung stehen dabei hauptsächlich jugendliche und erwachsene HPP-Patienten im Fokus der eCME.





Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin, Akupunktur
Chefarzt Abteilung Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerzmedizin Cura, GFO Kliniken Bonn
Lehrbeauftragter der Universität Bonn, Sprecher Arbeitskreis Tumorschmerz Deutsche Schmerzgesellschaft, Mitglied des ständigen Beirats der Deutschen Schmerzgesellschaft
- Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin / Urologie / Anästhesiologie / Palliativmedizin
Testosteronmangel - eine oft unerkannte Nebenwirkung von Opioiden und Koanalgetika
Testosteronmangel - eine oft unerkannte Nebenwirkung von Opioiden und Koanalgetika
Opioide werden aufgrund ihrer hohen analgetischen Potenz immer häufiger zur Therapie starker chronischer Schmerzen eingesetzt. Über bekannte Nebenwirkungen wie Obstipation, Übelkeit und Erbrechen hinaus kann sich die Anwendung von Opioiden allerdings auch negativ auf die körpereigene Testosteronproduktion auswirken. Viele männliche Patienten entwickeln daher unter einer längerfristigen Opioidtherapie einen opioidinduzierten Testosteronmangel, der oft mit spürbaren Symptomen assoziiert ist. Ein solcher durch Opioide ausgelöster männlicher Hypogonadismus wird jedoch häufig von Ärztinnen und Ärzten nicht erkannt.
Der Schmerzspezialist Priv.-Doz. Dr. Stefan Wirz (GFO-Kliniken Bonn, Betriebsstätte Cura Krankenhaus, Bad Honnef) stellt in dieser Fortbildung wichtige Studienergebnisse vor und berichtet über seine eigenen Erfahrungen zu diesem oft verkannten Krankheitsbild. Zudem gibt er praktische Tipps, wie die Beschwerden der Patienten wirksam gelindert und gleichzeitig deren Lebensqualität erhöht werden kann.





Ressortleiter Abrechnung, Medizin und Sonderproduktionen, ARZT & WIRTSCHAFT
- Allgemeinmedizin
Adhärenz durch Patientenmotivation steigern
Adhärenz durch Patientenmotivation steigern
Die Adhärenz bedingt wesentlich den Erfolg einer Therapie. Doch völlig unterschiedliche Faktoren können diese schmälern. Durch eine systematische Annäherung machen Sie die persönlichen Hemmschuhe des Patienten oder der Patientin ausfindig und können diesen gezielt und effektiv begegnen. Dabei können bestimmte kommunikative Strategien und Angebote an die Patienten und Patientinnen unterstützend wirken.





Chefarzt Hauptabteilung Gynäkologie
Leiter des interdisziplinären Brustzentrums
Rotkreuzklinikum München
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Hämatologie und Onkologie
Brustkrebs und Schwangerschaft
Brustkrebs und Schwangerschaft
Das Mammakarzinom zählt zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Frauen ab dem 25. Lebensjahr und betrifft Frauen im gebärfähigen Alter. Aufgrund des ansteigenden Alters Erstgebärender sind heutzutage zunehmend Schwangere und stillende Mütter von Brustkrebs betroffen.
Herr Prof. Braun geht auf den schwangerschaftsassoziierten Brustkrebs im Hinblick auf Epidemiologie, mögliche Ursachen, Outcome, Diagnostik und Therapie umfassend ein. Es wird verdeutlicht, dass das zeitliche Auftreten des Mammakarzinoms hinsichtlich der Prognose eine Rolle spielt. Des Weiteren werden mögliche Therapieoptionen wie Chemotherapie und systemische Therapie ebenso wie das Outcome des Kindes näher beleuchtet. Der Vortrag endet mit wichtigen Hinweisen zur Planung der Entbindung sowie zur Behandlung und Betreuung der schwangeren Patientinnen vor und nach der Geburt des Kindes. Herr Prof. Braun rundet den Vortrag mit wertvollen Praxiserfahrungen ab.




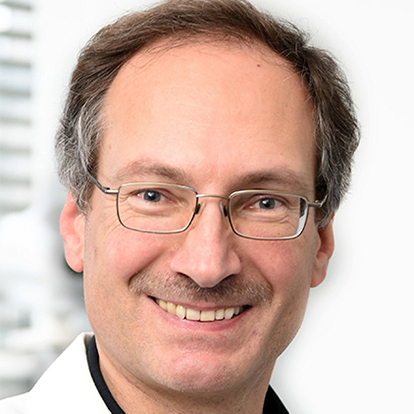
Ärztlicher Leiter der Augenklinik am Wittenbergplatz, Berlin
- Augenheilkunde
Medikamentöse lokale Therapie des primären Offenwinkelglaukoms
Medikamentöse lokale Therapie des primären Offenwinkelglaukoms
Das Glaukom ist eine neurodegenerative Erkrankung mit einer progredienten Optikusneuropathie, die unbehandelt zu einer schleichenden Erblindung führen kann. Neben zahlreichen bekannten Risikofaktoren ist der individuell zu hohe Augeninnendruck ein entscheidender Risikofaktor, der therapeutisch gut behandelbar ist. Es werden die derzeit verfügbaren Substanzklassen zur Augeninnendrucksenkung besprochen unter der besonderen Berücksichtigung ihrer Nebenwirkungen und Kontraindikationen.





Leitung Dysplasiezentrum Hamburg am Krankenhaus Jerusalem, Leitung Dysplasieeinheit, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Schwp. Gynäkologische Onkologie, Klinik für Gynäkologie, UKE Hamburg
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Hämatologie und Onkologie
Aktuelle Therapieoptionen beim fortgeschrittenen Zervixkarzinom
Aktuelle Therapieoptionen beim fortgeschrittenen Zervixkarzinom
Die Behandlung des fortgeschrittenen Zervixkarzinoms hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. In dieser Fortbildung werden aktuelle Therapieoptionen besprochen. Nach einer kurzen Einführung in Stadien und Prognose wird ein Überblick über aktuelle Entwicklungen für die fortgeschrittene primäre sowie die metastasierte / rezidivierte Situation gegeben. Anhand von Studiendaten werden verschiedene Situationen diskutiert und eine neue Zulassung als Ergänzung der Radiochemotherapie in die Therapielandschaft eingeordnet.





Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie, Kardiovaskuläres Zentrum Darmstadt und ärztliche Leitung (Amyloidose Sprechstunde), Universitätsklinikum Heidelberg
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie
Diagnostik und Differentialdiagnostik kardialer Amyloidosen (Schwerpunkt AL-Amyloidose)
Diagnostik und Differentialdiagnostik kardialer Amyloidosen (Schwerpunkt AL-Amyloidose)
Amyloidosen entstehen durch die extrazelluläre Ablagerung von Amyloidfibrillen in verschiedenen Organen, insbesondere im Herzen, und sind gekennzeichnet durch einen progressiven Verlauf. Die zeitliche Diskrepanz zwischen ersten Amyloidablagerungen und Auftreten von klinischen Zeichen oder Symptomen erschwert die rechtzeitige Diagnose. Diese ist bei einer Leichtketten (AL)-Amyloidose jedoch essenziell, um frühzeitig eine kausale Therapie zu beginnen und das Überleben zu verbessern. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Kristen in einem spannenden Vortrag die Diagnostik und Differentialdiagnostik kardialer Amyloidosen. Nach einer Einführung in die Epidemiologie werden häufige Amyloidoseformen vorgestellt. Im Fokus der Betrachtung steht dabei die AL-Amyloidose. Sie erhalten wertvolle Informationen, wann an eine kardiale Amyloidose gedacht werden sollte und wie bei Verdacht auf diese die Diagnostik erfolgt. Neben der Bildgebung z. B. mit Echokardiographie oder kardialem MRT werden auch Biopsie und Laborparameter thematisiert. Abgerundet wird die Fortbildung durch Empfehlungen zur Therapie, die sowohl aktuelle Therapieansätze der AL-Amyloidose inklusive supportiver Behandlungsmaßnahmen als auch zukünftige Optionen umfasst.





Fachärztin für AllgemeinmedizinMünchen
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Allgemeinmedizin
Diabetes in der Schwangerschaft - Herausforderndes Duo
Diabetes in der Schwangerschaft - Herausforderndes Duo
Diabetes in der Schwangerschaft, einschließlich Gestationsdiabetes und präexistenter Formen, birgt erhebliche Risiken für Mutter und Kind und erfordert spezifische, leitlinienbasierte Ansätze zur Prävention und Therapie. Neueste Erkenntnisse betonen die Bedeutung der präkonzeptionellen Beratung, der engmaschigen Blutzuckerkontrolle und individualisierter Insulintherapien. Diese Fortbildung vertieft den aktuellen Stand zu Diagnostik, Therapie und langfristigem Risikomanagement und bietet konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung der Versorgung. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um evidenzbasiertes Wissen zu vertiefen und klinische Ergebnisse nachhaltig zu verbessern.





MD, MPH, MBA, FRANZCP
Klinikdirektor, Klinik für Psychische Gesundheit
Universitätsklinikum Münster
- Psychiatrie und Psychotherapie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin
Therapieresistente Depression (TRD) und aktuelle Behandlungsoptionen
Therapieresistente Depression (TRD) und aktuelle Behandlungsoptionen
Affektive Störungen stehen an erster Stelle der weltweiten Krankheitslast. 35-40 % der Betroffenen einer Unipolaren Depression entwickeln eine behandlungsresistente Depression (TRD). Die hohen Rückfallraten von bis zu 70 % im Verlauf der Erkrankung zeigen die Herausforderung im Therapiemanagement.
Nach einer kurzen Einführung erläutert Herr Prof. Baune die Therapien nach der aktuellen Nationalen VersorungsLeitlinie Unipolare Depression und stellt sie im Einzelnen vor. Hier erfahren Sie u.a. welche Möglichkeiten nach Nichtansprechen zur Verfügung stehen, welche Residualsymptome mit welchen Folgen auftreten können und warum ein frühzeitiger Therapiebeginn von Vorteil ist. Auch die Kombinations- und Erhaltungstherapien werden vorgestellt und die Relevanz von nicht-medikamentösen Verfahren erörtert.





Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, UKE Hamburg
- Intensivmedizin / Infektiologie
Bakterielle Resistenzmechanismen - multiresistente Erreger (MRE)
Bakterielle Resistenzmechanismen - multiresistente Erreger (MRE)
Nach der Lektüre des Beitrags kennen Sie die Ursachen für bakterielle Resistenzen als biologisches Phänomen einschließlich klinik- und patientenspezifischer Risikofaktoren für Kolonisation oder Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE), sind Ihnen die wichtigsten grampositiven und gramnegativen MRE bekannt. Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten bakteriellen Resistenzmechanismen und die davon betroffenen Antibiotika und Sie kennen Sie die wichtigsten im Zusammenhang mit Multiresistenz verwendeten Begriffe und deren Abkürzungen.





Leitende Ärztin LMU Klinikum
Stabsstelle Klinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene
München
- Laboratoriumsmedizin / Innere Medizin / Infektiologie / Intensivmedizin
Sepsis und Blutstrominfektionen - Herausforderungen der antimikrobiellen Therapie
Sepsis und Blutstrominfektionen - Herausforderungen der antimikrobiellen Therapie
Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse zu der Definition von Blutstrominfektionen sowie Sepsis, wissen, welche Risikofaktoren eine Sepsis begünstigen und Sie sind damit vertraut, worauf bei der Blutkulturdiagnostik im klinischen Alltag zu achten ist. Sie haben Kenntnisse zur Epidemiologie, Inzidenz und Letalität von Blutstrominfektionen und Sepsis und kennen die aktuellen Empfehlungen der Surviving-Sepsis-Campaign zum Sepsis-Management. Sie verfügen über Informationen bezüglich der Risikofaktoren für Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE) bei Blutstrominfektionen und Sepsis einschließlich der Implikationen für die Therapie. Sie kennen das Erregerspektrum der Sepsis in Abhängigkeit vom Ausgangsherd der Infektion und haben Kenntnisse bzgl. der Therapieempfehlungen in den aktuellen Leitlinien.





Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene, UKE Hamburg
- Intensivmedizin / Infektiologie
Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick
Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick
Das CME-Modul "Infektionen durch multiresistente gramnegative bakterielle Erreger im Überblick" gibt einen Überblick über: die Prävalenz multiresistenter Erreger im Klinikalltag, aktuelle Therapieempfehlungen und die besondere Herausforderung bei der Behandlung von Infektionen durch multiresistente gramnegative Erreger. Sie informiert hierbei über ESBL-bildende sowie Carbapenemase-bildende Infektionserreger, über Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii und die Bedeutung einer adäquaten empirischen Initialtherapie.





Oberarzt, Leiter der rheumatologischen Fachambulanz
Klinik für Rheumatologie und Klinische Immunologie
- Rheumatologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin
Glukokortikoide beim Lupus Management
Glukokortikoide beim Lupus Management
Systemischer Lupus erythematodes (SLE) ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die durch Autoantikörperbildung und entzündliche Prozesse mehrere Organsysteme betreffen und zu schwerwiegenden Krankheitsverläufen führen kann.
Anhand von 14 gezielten Fragen behandelt diese Fortbildung die Grundlagen der SLE, hinterfragt die Wirksamkeit und Sicherheit einer Glukokortikoid-Therapie und beleuchtet Strategien zum Shared Decision-Making (SDM). Erfahren Sie, wie Sie Glukokortikoide dosieren, therapieassoziierte Risiken minimieren und Ihre Patienten gezielt bei Therapieentscheidungen unterstützen können.
Diese eCME bietet wertvolle Einblicke und praxisorientierte Ansätze für ein optimiertes und patientenzentriertes SLE-Management.





Stellvertretende Direktorin & Bereichsleitung Gynäkologische Onkologie der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Medizinische Hochschule Hannover
- Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Hämatologie und Onkologie
Endometriumkarzinom - Wie ändert sich die Routine?
Endometriumkarzinom - Wie ändert sich die Routine?
Das Endometriumkarzinom (EC) zählt zu den häufigsten Tumorarten der Frau und ist eine der wenigen Malignitäten mit steigender Inzidenz und Mortalität.
In dieser Fortbildung beleuchtet Frau Professor Park-Simon aktuelle Entwicklungen in der molekularen Klassifikation sowie neue Therapieoptionen für die Behandlung von Patientinnen mit Endometriumkarzinom im fortgeschrittenen oder rezidivierten Stadium. Sie erhalten praxisrelevante Einblicke in die Anwendung der neuen FIGO-Klassifikation und deren Einfluss auf die Risikoabschätzung und Prognose. Aktuelle Entwicklungen zu Immuntherapien (Immuncheckpoint-Inhibition, ICI) und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADC) werden basierend auf den neuesten Studiendaten vorgestellt und die für den klinischen Alltag relevanten Erkenntnisse am Ende des Vortrags zusammengefasst.



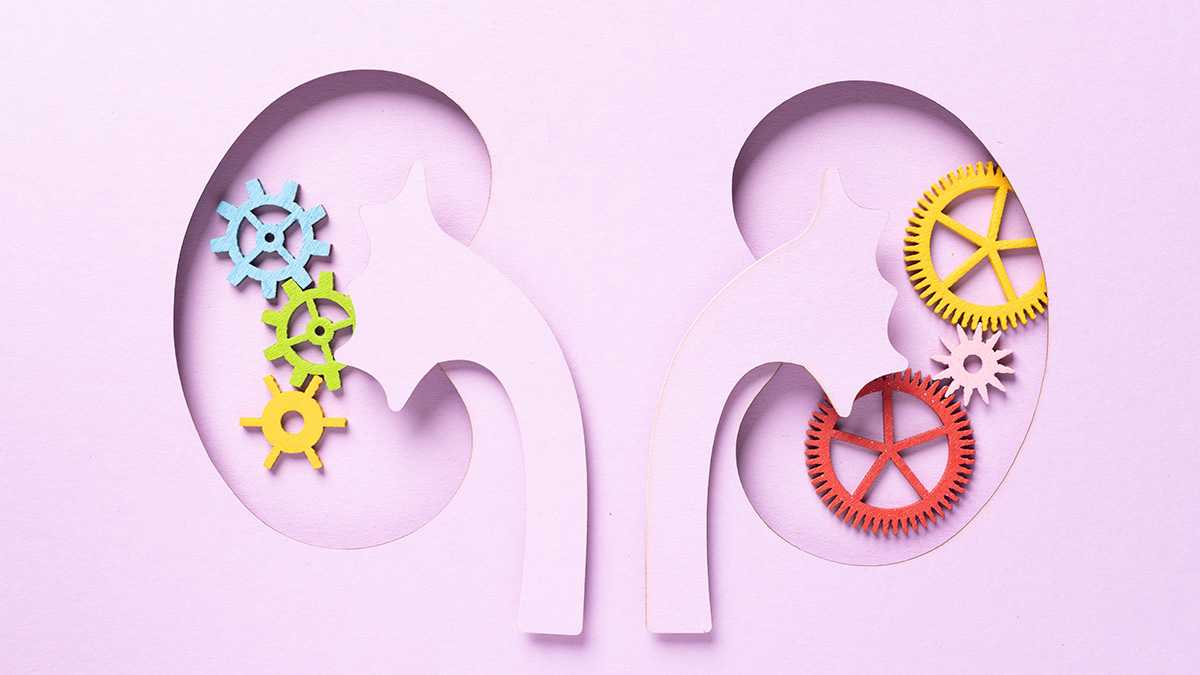
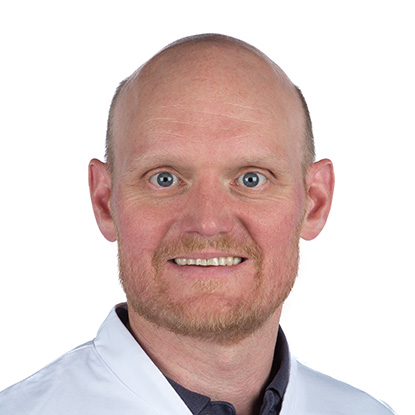
Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie,
Transplantationsmedizin, Oberarzt
Universitätsklinikum Münster
- Nephrologie / Innere Medizin
Dialyse und Nierentransplantation: Wie managen Sie die Komorbiditäten sHPT und Hyperkaliämie?
Dialyse und Nierentransplantation: Wie managen Sie die Komorbiditäten sHPT und Hyperkaliämie?
Diese Fortbildung beleuchtet zwei zentrale Komorbiditäten, deren Berücksichtigung für das Management von dialysepflichtigen und nierentransplantierten Patienten essenziell ist: Hyperkaliämie und sekundärer Hyperparathyreoidismus.
Im ersten Teil beschreibt Herr Prof. Tölle die Risiken der Hyperkaliämie, einer häufigen und potenziell lebensbedrohlichen Komplikation, die insbesondere Dialysepatienten sowie Patienten nach Nierentransplantation betrifft. Er stellt verschiedene Managementansätze vor, darunter die Kontrolle der Kaliumwerte durch diätetische Anpassungen, Medikamentenanpassungen und den Einsatz von Kaliumbindern, um Komplikationen zu verhindern und die Prognose der Patienten zu verbessern.
Im zweiten Teil geht Herr Prof. Reuter auf den sekundären Hyperparathyreoidismus ein, der sich durch erhöhte Parathormonspiegel infolge von Kalzium- und Vitamin-D-Mangel äußert, einen Großteil der Patienten nach Nierentransplantation betrifft und das Transplantat-Outcome beeinträchtigen kann. Er zeigt spezifische Therapiestrategien und -empfehlungen auf, um den Mineralhaushalt zu regulieren und das Risiko von Komplikationen zu mindern.





Fachärztin für Pneumologie, Allergologie und Infektiologie
Praxisinhaberin Pneumologie Süderelbe - Hamburg
Professur apl. an der Medizinischen Hochschule Hannover
- Infektiologie / Intensivmedizin / Pneumologie
Nosokomiale Pneumonie (HAP) und Beatmungspneumonie (VAP) - Update 2024
Nosokomiale Pneumonie (HAP) und Beatmungspneumonie (VAP) - Update 2024
Nach der Lektüre des Beitrags haben Sie Kenntnisse bezüglich der Definitionen und Einteilung nosokomialer Pneumonien (HAP und VAP) sowie deren Charakteristika, und wissen, welche Risikofaktoren die Entwicklung einer nosokomialen Pneumonie begünstigen. Sie haben HAP/VAP-Kenntnisse zur Epidemiologie, Inzidenz und Letalität, kennen die Empfehlungen bezüglich diagnostischer Maßnahmen bei Verdacht auf HAP und deren Bewertung und verfügen über Informationen bezüglich der Risikofaktoren für HAP/VAP durch multiresistente Erreger (MRE). Sie kennen das Erregerspektrum der nosokomialen Pneumonie in Abhängigkeit zu patientenspezifischen Risikofaktoren, haben Kenntnisse bzgl. der Therapieempfehlungen in den aktuellen Leitlinien und deren Bedeutung auf den Therapieverlauf und Sie sind vertraut mit Therapieempfehlungen zur HAP/VAP-Behandlung bei Nachweis von MRE.