Aktuelle CME
Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.





Geschäftsführender Oberarzt,
Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie,
Universitätsklinikum Ulm
- Innere Medizin / Gastroenterologie / Radiologie / Augenheilkunde / Rheumatologie
IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon
IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon
Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die verschiedene Organe wie z. B. Pankreas, Gallenwege, Speichel- und Tränendrüsen, Nieren oder Aorta befallen kann. Die IgG4-RD ist differenzialdiagnostisch sehr komplex und wird in dieser Fortbildung von Herrn Prof. Kleger und Herrn Dr. Vogele in einem spannenden Austausch praxisnah anhand von Patientenkasuistiken besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zu den diagnostischen Kriterien und Bildgebungsmerkmalen und erhalten wertvolle Informationen, wie sich die IgG4-assoziierte Erkrankung von anderen Erkrankungen abgrenzen lässt. Es werden Grundlagen beispielsweise zur Pathogenese, zum klinischen Bild und zum Auftreten vermittelt sowie mögliche Therapieoptionen besprochen, um Rezidive und Organschäden zu verhindern. Diese Fortbildung bietet Basiswissen zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit einer IgG4-RD und dient zur Weiterentwicklung der Expertise im Management dieser schwerwiegenden und differenzialdiagnostisch anspruchsvollen Erkrankung.



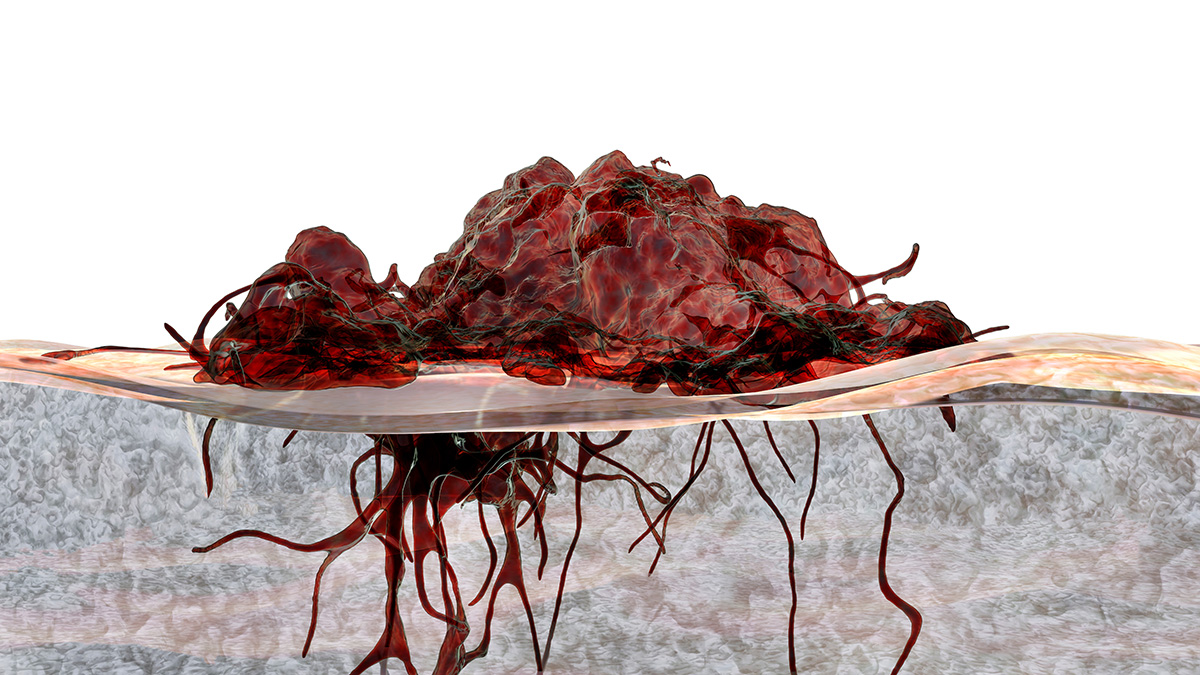

Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie, Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie
Campus Virchow-Klinikum der Charité - Universitätsmedizin Berlin
Direktor, Charité Comprehensive Cancer Centers (CCCC)
Geschäftsführender Direktor und Sprecher, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) Berlin
- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Innere Medizin
Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neues zur Erhaltungstherapie
Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neues zur Erhaltungstherapie
Das kolorektale Karzinom gehört zu den häufigsten malignen Tumoren in den deutschsprachigen Ländern. Trotz effektiver Primärtherapie und Fortschritten in der adjuvanten Behandlung entwickeln viele Patienten Metastasen. Da die Erstlinientherapie bei fitten Patienten mit nicht-resektablen Metastasen mit dem Auftreten von Nebenwirkungen assoziiert sein kann, ist sie konsekutiv oft nicht bis zum Progress durchführbar. Aus diesem Grund hat sich beim metastasierten kolorektalen Karzinom (mCRC) eine Erhaltungstherapie bewährt, welche im Rahmen dieser Fortbildung von Herrn Prof. Modest praxisorientiert besprochen wird. Sie erhalten einen Überblick zu den wichtigsten und neuesten Studien und erfahren, wie durch gezielte Erhaltungstherapien das progressionsfreie Überleben (PFS) verlängert werden kann. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration der neuen Erkenntnisse in die Behandlungsstrategien zur Optimierung der Therapie von mCRC-Patienten. Abgerundet wird diese Fortbildung durch die Empfehlungen der aktuellen ESMO Leitlinien. Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihr Wissen zur Erhaltungstherapie bei Patienten mit mCRC auf dem neuesten Stand zu bringen.





Fachärztin für Innere Medizin, Gastroenterologie;
Oberärztin, Bereichsleitung CED, Universitätsklinikum Augsburg
- Gastroenterologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin
Therapie bei leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa
Therapie bei leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa
Die Inzidenz chronisch entzündlicher Darmerkrankungen (CED) nimmt weltweit stetig zu. Mehr als Dreiviertel der Patienten mit Colitis ulcerosa (CU) zeigen bei Diagnosestellung eine leichte bis mittelschwere Verlaufsform. Diese CME vermittelt praxisnahes Wissen zu Epidemiologie, Pathophysiologie, Klassifikation und dem Step-up-Therapiekonzept bei CU. Leitliniengerechte Therapieoptionen der unterschiedlichen Phänotypen werden anhand aktueller klinischer Studien und praktischer Empfehlungen erläutert. Abgerundet wird die Fortbildung durch Strategien zur Therapieoptimierung und Verlaufskontrolle. Nach Abschluss der CME verfügen Teilnehmer über fundiertes Wissen, um Patienten mit leichter bis mittelschwerer Colitis ulcerosa leitlinienkonform und effektiv zu behandeln.



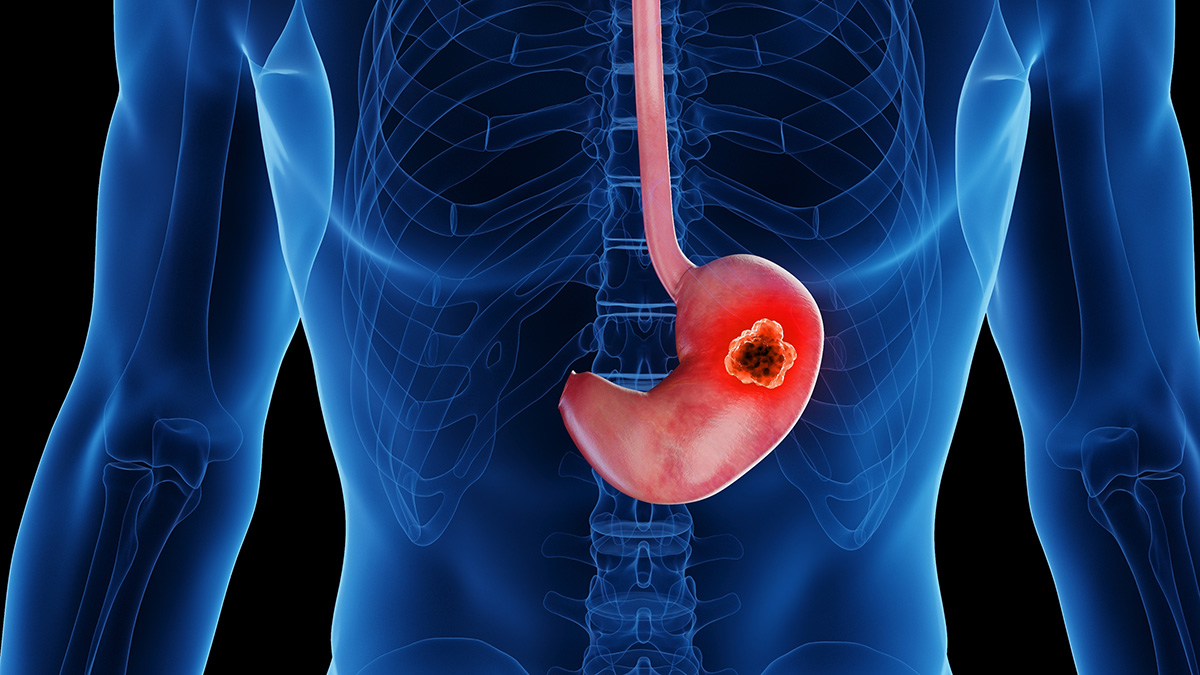

Oberärztin, Schwp. Gastrointestinale Tumore, Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III, TUM Klinikum Rechts der Isar, München
- Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Pathologie
Das metastasierte Magenkarzinom im Fokus – Leitlinien im Versorgungsalltag
Das metastasierte Magenkarzinom im Fokus – Leitlinien im Versorgungsalltag
Das metastasierte Magenkarzinom zählt weltweit zu den großen onkologischen Herausforderungen. Durch Fortschritte in der molekularen Charakterisierung und die Entwicklung neuer zielgerichteter und immunonkologischer Ansätze eröffnen sich jedoch zunehmend verbesserte Therapieoptionen und Perspektiven für die Betroffenen.
Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Prof. Lorenzen einen kompakten Überblick über den aktuellen Therapiestandard beim metastasierten Magenkarzinom und zeigt, wie sich die Empfehlungen der aktuellen Leitlinien (ESMO, Onkopedia) im Versorgungsalltag praxisnah umsetzen lassen. Biomarker-gesteuerte Strategien prägen dabei zunehmend die individuelle Therapieentscheidung und das Behandlungsergebnis. Anhand aktueller Studiendaten werden die Standards der Erst- und Zweitlinientherapie anschaulich erläutert, ebenso die Bedeutung zentraler Biomarker (HER2, PD-L1, MSI, CLDN 18.2) und die Anwendung moderner Leitlinienalgorithmen vorgestellt.



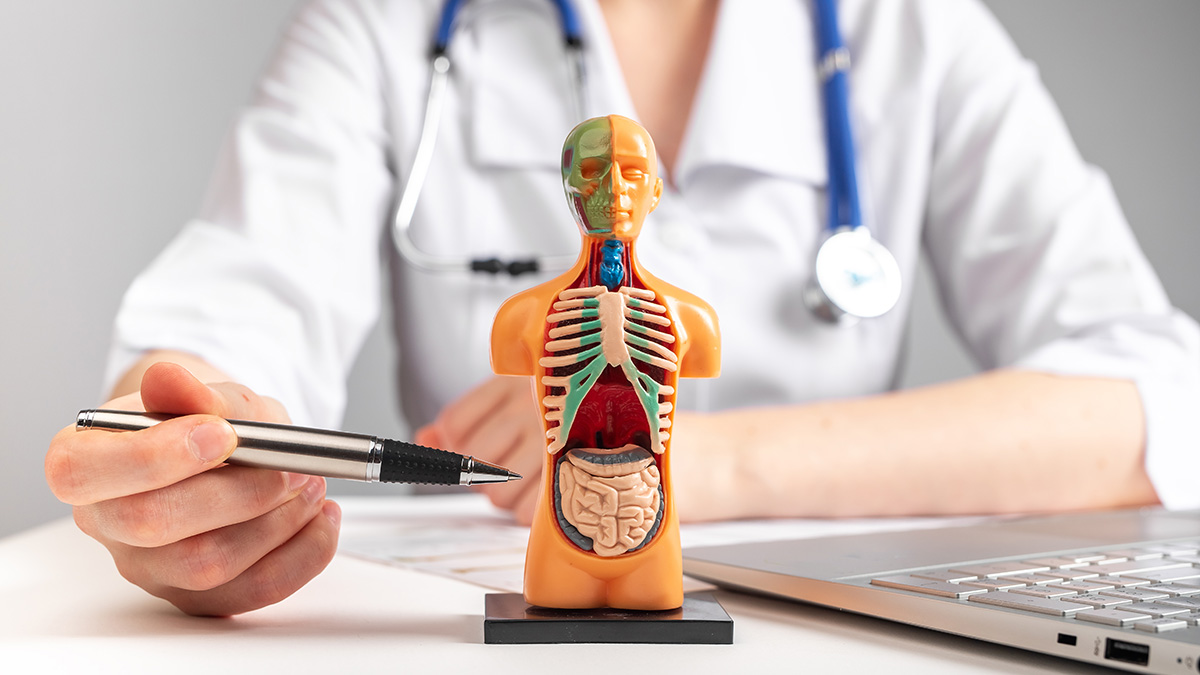

MBA, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie,
Chefarzt, Klinik für Innere Medizin, Ärztlicher Direktor,
Klinikum Forchheim - Fränkische Schweiz gGmbH
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Innere Medizin
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) aus allgemeinärztlicher Sicht
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) aus allgemeinärztlicher Sicht
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn (MC) und Colitis ulcerosa (CU) sind chronische Entzündungen des Verdauungstrakts, die auch extraintestinale Manifestationen umfassen können. Der Allgemeinmediziner spielt eine zentrale Rolle in der frühzeitigen Diagnostik von CED sowie in der Langzeitbetreuung milder Krankheitsverläufe. Diese Fortbildung von Herrn Prof. Gschossmann bietet einen umfassenden Überblick über Krankheitsbild, Diagnostik und Therapie sowie über die Versorgungsebenen von CED samt wertvoller Vernetzung zwischen Hausärzten, Fachärzten und spezialisierten Zentren. Sie erhalten wichtige Informationen zur Diagnostik und zu Differenzialdiagnosen von CED und das Erkennen von „Red Flags“ sowie der Unterschiede beispielsweise zum Reizdarm. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Therapieoptionen samt Empfehlungen der aktuellen S3-Leitlinien z. B. zu Substratmangel und Ernährung und bekommen wertvolle Informationen zu besonderen CED-Patient:innen wie z. B. ältere Patient:innen und schwangeren Frauen sowie besonderen Situationen wie Impfungen. Diese Fortbildung bietet praxisnahe Informationen, um eine fundierte Versorgung von CED-Patient:innen zu gewährleisten und dient dazu, das Verständnis für diese komplexen Erkrankungen zu vertiefen.





Institutsleitung / Direktorin, Institut für Pathologie,
Heinrich-Heine-Universität / Universitätsklinikum Düsseldorf
- Pathologie / Gastroenterologie / Innere Medizin
IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik
IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) - Ein Überblick zur pathologischen Diagnostik
Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die sich am häufigsten im Pankreas, in den Gallenwegen und in den Speichel- und Tränendrüsen manifestiert. Die Diagnose basiert auf einer Integration von klinischen, radiologischen, serologischen und histopathologischen Kriterien. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Prof. Esposito einen umfassenden Überblick über die pathologische Diagnostik der IgG4-RD. Nach einer Einführung zum Krankheitsbild samt Klinik, Manifestationen und Pathogenese wird dabei auf die histopathologischen Kriterien und die klinischen Aspekte der Autoimmunpankreatitis (AIP) Typ 1 und Typ 2 eingegangen. Anhand anschaulicher histologischer Bilder werden anschließend typische Befunde erläutert, ergänzt durch praxisnahe Hinweise zur Beurteilung von Biopsiematerial. Eine Checkliste zur Diagnose der AIP Typ 1 und Typ 2 rundet diese Fortbildung ab. Nutzen Sie diese, die Erkrankung IgG4-RD sicher zu erkennen und Fehldiagnosen insbesondere maligne Tumoren zu vermeiden.





Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie
Internistenzentrum MVZ Gauting-Starnberg
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren
Funktionelle Verdauungsbeschwerden - Leitliniengerecht behandeln
Funktionelle Verdauungsbeschwerden - Leitliniengerecht behandeln
Funktionelle Verdauungsbeschwerden zählen zu den häufigsten Ursachen gastrointestinaler Symptome und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich. Trotz ihrer hohen Prävalenz bleiben sie oft eine diagnostische und therapeutische Herausforderung. Diese Fortbildung vermittelt praxisnah, wie der Reizmagen (funktionelle Dyspepsie) und das Reizdarmsyndrom leitliniengerecht diagnostiziert und behandelt werden können.
Lernen Sie funktionelle Beschwerden differenzialdiagnostisch einzuordnen, pathophysiologische Zusammenhänge wie das Konzept der Darm-Hirn-Achse, viszerale Hypersensitivität und Mikrobiomveränderungen zu verstehen und patientenzentrierte Behandlungsstrategien umzusetzen. Im Fokus steht die multimodale Therapie, die neben Ernährungs- und Lebensstilmaßnahmen auch psychoedukative Ansätze, Mind-Body-Techniken und phytotherapeutische Optionen berücksichtigt.
Ziel ist es, die diagnostische Sicherheit zu stärken, die Kommunikation mit Betroffenen zu verbessern und individualisierte Therapiekonzepte auf Grundlage aktueller Leitlinien zu entwickeln.





Facharzt für Innere Medizin,
Schwerpunkt Gastroenterologie / Hepatologie
Senior Consultant für das Centrum Gastroenterologie Bethanien am Bethanien Krankenhaus Frankfurt
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren
Update Reizmagen und Reizdarm – Gestörte Interaktion Verdauungstrakt-Hirn
Update Reizmagen und Reizdarm – Gestörte Interaktion Verdauungstrakt-Hirn
Funktionelle Erkrankungen des Verdauungstraktes sind häufig. Ca. 10 – 20 % der erwachsenen Bevölkerungen leiden an einem Reizmagen oder Reizdarmsyndrom. Die Pathophysiologie ist komplex und bisher noch nicht vollständig verstanden. Da es sich um eine Ausschlussdiagnostik handelt, ist die Diagnose oft nicht ganz einfach.
In dieser Fortbildung erläutert Herr Prof. Joachim Labenz vom Klinikum Jung-Stilling in Siegen die wichtigsten Aspekte rund um Definition, Diagnostik und Therapie des Reizmagens und des Reizdarmsyndroms. Neben Allgemeinmaßnahmen und medikamentösen Therapieoptionen werden auch Phytotherapeutika und Ernährungsempfehlungen wie die Low-FODMAP-Ernährung vorgestellt.





Stellv. ärztliche Leitung Präzisionsonkologie Programm CCC,
Medizinische Klinik und Poliklinik III,
LMU Klinikum München
- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Innere Medizin
Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neue (und alte) Biomarker für eine zielgerichtete Behandlung
Metastasiertes kolorektales Karzinom - Neue (und alte) Biomarker für eine zielgerichtete Behandlung
Das kolorektale Karzinom (CRC) ist die dritt-häufigste Tumorerkrankung weltweit. Bereits bei Diagnose sind ca. 25 % der Patient:innen im metastasierten Stadium. In den letzten Jahren hat die interdisziplinäre Behandlung aber auch die Biomarker-getriebene Therapie zu einer Verbesserung der Prognose von Patient:innen mit mCRC geführt. Diese zielgerichtete Behandlung mit neuen und alten Biomarkern wird im Rahmen der Fortbildung von Frau Dr. Heinrich besprochen. Sie erfahren nach einer kurzen Einführung zur Epidemiologie, Therapiezielen und Behandlungsstrategien das Wichtigste zu den molekular gesteuerten Standardtherapien. Als Grundlage dafür dient der Therapiealgorithmus der ESMO-Leitlinie. Der besondere Fokus liegt dabei auf den klinischen Biomarkern RAS, BRAF und MSI. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Informationen zu neuen molekular zielgerichteten Therapien und Biomarkern wie z. B. KRAS G12C und HER2. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur zielgerichteten Behandlung bei Patienten mit mCRC auf den neuesten Stand zu bringen.



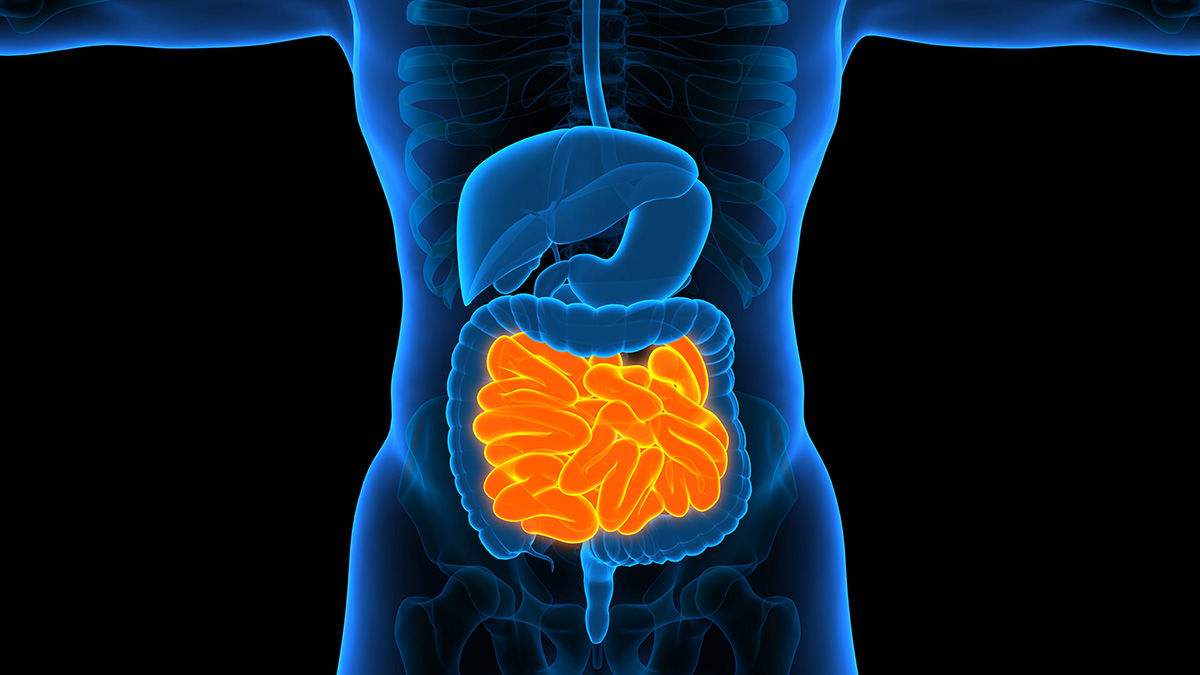

Bereichsleitung Gastrointestinale Tumore und ENETS Zentrum Neuroendokrine Tumore
Universitätsklinikum Marburg
- Hämatologie und Onkologie / Gastroenterologie / Nuklearmedizin / Innere Medizin
Aktuelles Praxiswissen zur ENETS-Leitlinie: NET des Dünndarms
Aktuelles Praxiswissen zur ENETS-Leitlinie: NET des Dünndarms
Dünndarm-NET gehören zu den häufigsten NET. Nachdem die WHO-Klassifikation aktualisiert und die Leitlinie der Europäischen Neuroendokrinen Tumorgesellschaft (ENETS) überarbeitet wurde, stellen Frau Prof. Rinke und Frau Prof. Pavel anhand der Schlüsselfragen aus der ENETS-Leitlinie die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Aspekte, sowie Neuerungen zum Dünndarm-NET vor. Unter Hinzunahme von Bildmaterial und Kasuistiken führen die beiden Referentinnen im Dialog praxisnah durch die Empfehlungen zur Diagnostik, Therapie und Nachsorge, wobei auch auf die Besonderheiten bei Vorliegen eines Karzinoid-Syndroms eingegangen wird.





Facharzt für Hämatologie und internistische Onkologie, Innere Medizin, Zusatzbezeichnung Palliativmedizin,
Chefarzt, Klinik für Onkologie, Hämatologie, Palliativmedizin, Rheumatologie und Pneumologie,
Medizinischer Vorstand, Asklepios Tumorzentrum Hamburg, Asklepios Klinik Altona
- Gastroenterologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Metastasiertes kolorektales Karzinom (mCRC): Aktuelle Behandlungsoptionen in der therapierefraktären Situation
Metastasiertes kolorektales Karzinom (mCRC): Aktuelle Behandlungsoptionen in der therapierefraktären Situation
Das metastasierte kolorektale Karzinom (mCRC) ist bei Frauen der zweit- und bei Männern der dritthäufigste maligne Tumor in den deutschsprachigen Ländern. Bei Erstdiagnose liegt bei einem Viertel der Patienten bereits eine Fernmetastasierung vor. Die Behandlungsoptionen sind in späten Therapielinien begrenzt und der Anteil der Patienten, die eine Therapie erhalten sowie die Überlebensraten nehmen mit jeder Behandlungslinie ab. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie von Herrn Prof. Arnold das Wichtigste zu den aktuellen Behandlungsoptionen in der therapierefraktären Situation, wobei neben etablierten Therapien auch neue Wirkansätze im Fokus stehen. Sie erfahren unter anderem, welche Kriterien für die Therapiewahl bei mehrfach vorbehandelten mCRC-Patienten entscheidend sind und welchen Stellenwert innovative Substanzen im klinischen Alltag einnehmen können. Besonders hervorgehoben wird dabei die Balance zwischen Wirksamkeit, Verträglichkeit und Erhalt der Lebensqualität. Diese praxisorientierte Fortbildung bietet eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den onkologischen Alltag und unterstützt dabei, sich mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der Spätlinientherapie bei Patienten mit mCRC auseinanderzusetzen.





Fachärztin für Innere Medizin und Hämostaseologie,
Leiterin der Angioödem-Ambulanz u. interdisziplinärem HAE-Kompetenzzentrum,
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Frankfurt
- Hals-Nasen-Ohrenheilkunde / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Gastroenterologie / Kinder- und Jugendmedizin
Dem Hereditären Angioödem auf der Spur: Patientenfälle aus der Praxis bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Dem Hereditären Angioödem auf der Spur: Patientenfälle aus der Praxis bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
Das hereditäre Angioödem (HAE) ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die sich durch wiederkehrende Schwellungsattacken äußert. Erste HAE-Symptome können bereits im frühen Kindesalter auftreten, die Diagnose erfolgt oft erst Jahre später. Im Rahmen dieser praxisnahen Fortbildung werden anhand realer Fallbeispiele aus der Pädiatrie, Jugend- und Erwachsenenmedizin typische Verläufe, diagnostische Herausforderungen und Therapieentscheidungen bei Patient:innen mit HAE beleuchtet. Sie erhalten wertvolle Informationen zu Schwellungsattacken wie beispielweise zu abdominellen Attacken, zu möglichen Triggern und zu Komedikationen, auf die bei HAE-Patient:innen geachtet werden sollten. Darüber hinaus erfahren Sie, wie wichtig eine frühzeitige Diagnose ist und dass das HAE auch bei Patient:innen ohne bekannte Familienanamnese mittels De Novo Mutationen auftreten kann. Diese Fortbildung sensibilisiert für seltene, aber klinisch relevante Differenzialdiagnosen und motiviert zur vertieften Auseinandersetzung mit einem Krankheitsbild, das im Praxisalltag leicht übersehen werden kann.





Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie
Internistenzentrum MVZ Gauting-Starnberg
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie / Naturheilverfahren
Das Reizdarmsyndrom - Therapie von FODMAP bis Gluten
Das Reizdarmsyndrom - Therapie von FODMAP bis Gluten
Die Diagnose Reizdarmsyndrom (RDS) ist nicht einfach und sollte erst nach Ausschluss anderer Ursachen in Betracht gezogen werden. Umfassende diagnostische Verfahren sind dabei erforderlich. Differentialdiagnostisch sollte unbedingt an Zöliakie, Weizenallergie und NZNW-Weizensensitivität (Glutensensitivität) gedacht werden, welche eine Vielzahl extra- und intestinaler Symptome hervorrufen können.
Erfahren Sie in dieser Fortbildung mehr zur Pathophysiologie, Symptomatik und Diagnostik des Reizdarmsyndroms. Neben Therapiemöglichkeiten, supportiven Maßnahmen und Empfehlungen zu Ernährung und Lebensstil wird auch die Rolle von FODMAPs und Gluten in der Therapie des RDS ausführlich diskutiert.





Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie und Infektiologie, Schwerpunkte: Hepatologie und Infektionsmedizin,
Leitender Oberarzt, Bereichsleitung Hepatologie,
Universitätsklinkum Tübingen
- Gastroenterologie / Innere Medizin
Diagnose und Therapie seltener cholestatischer Lebererkrankungen (PBC, PSC, PFIC)
Diagnose und Therapie seltener cholestatischer Lebererkrankungen (PBC, PSC, PFIC)
Seltene cholestatische Lebererkrankungen wie die primär biliäre Cholangitis (PBC), die primär sklerosierende Cholangitis (PSC) und progressive familiäre intrahepatische Cholestasen (PFIC) können in Diagnostik und Therapie eine besondere Herausforderung darstellen - nicht zuletzt wegen unspezifischer Symptome wie Juckreiz und Ikterus und oft progredientem Verlauf. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Prof. Berg anhand der Empfehlungen der aktuellen S3-Leitlinie und Fallbeispielen praxisrelevantes Wissen zur frühzeitigen Diagnose und Behandlung von Patienten mit PBC, PSC und PFIC. Sie erhalten wertvolle Informationen zum klinischen Bild der Patienten, zur Klassifikation der Erkrankungen, welche Therapieoptionen eingesetzt werden können und wann gezielt überwacht werden muss, um beispielsweise hepatobiliäre Karzinome zu detektieren. Diese Fortbildung vermittelt kompakt und praxisnah die entscheidenden Grundlagen und aktuellen Entwicklungen im Management seltener cholestatischer Lebererkrankungen und soll Sie dabei unterstützen, die Prognose und Lebensqualität der Patienten gezielt zu verbessern.





Direktor
Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin
Universitätsklinikum Halle (Saale)
- Innere Medizin / Gastroenterologie
Exokrine Pankreasinsuffizienz (PEI): neue UEG-Leitlinie 2025
Exokrine Pankreasinsuffizienz (PEI): neue UEG-Leitlinie 2025
Diese Fortbildung bietet Ihnen einen praxisorientierten Überblick zur neuen UEG-Leitlinie zur exokrinen Pankreasinsuffizienz (PEI). Anhand aktueller Evidenz und verschiedenen Fallbeispielen werden Diagnostik, Ursachen und Therapieoptionen kompakt und klinisch relevant dargestellt. Ideal für alle, die PEI häufiger erkennen und gezielt behandeln möchten.





Chefärztin der Klinik für Innere Medizin-Gastroenterologie-Kardiologie-Pneumologie-Palliativmedizin-Diabetologie
St. Marien-und Annastiftskrankenhaus,
Ludwigshafen am Rhein
- Gastroenterologie / Innere Medizin
Aktuelle Therapien bei Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Aktuelle Therapien bei Chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind entzündliche Systemerkrankungen, die nicht rechtzeitig erkannt und behandelt zu Komplikationen wie Fisteln, Stenosen oder Operationen führen können. Eine frühzeitige Therapie kann Komplikationen verhindern und den Krankheitsverlauf günstig beeinflussen. In dieser Fortbildung bietet Prof. Dr. Tanja Kühbacher einen vollständigen Überblick über alle derzeit zugelassenen Therapieoptionen bei CED und diskutiert diese im Kontext aktueller Studienergebnisse, praktischer Anwendung und Langzeitsicherheit.
Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen zu zeigen, wie sich alle aktuell verfügbaren CED-Therapien evidenzbasiert einsetzen lassen, welche Patienten vom frühen, intensiven Therapiebeginn besonders profitieren und wie sich durch strukturiertes Monitoring langfristig bessere Outcomes erzielen lassen.





Direktorin der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
- Gastroenterologie
Grundlagen, Diagnostik und Management der PBC
Grundlagen, Diagnostik und Management der PBC
Die primär biliäre Cholangitis (PBC) ist eine seltene Autoimmunerkrankung der Leber, die vor allem Frauen ab dem mittleren Lebensalter betrifft. Charakteristisch ist eine fortschreitende Zerstörung der kleinen intrahepatischen Gallenwege, die unbehandelt zu Fibrose, Leberzirrhose und letztlich Leberversagen führen kann. Klinisch fällt sie häufig früh durch Juckreiz auf – ein Symptom, das bei starker Ausprägung die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann.
Diese Fortbildung bietet praxisnahe Einblicke in die Pathophysiologie, Diagnostik und das Krankheitsmanagement der PBC – von der frühen Erkennung über die Risikostratifizierung bis zur therapeutischen Entscheidungsfindung. Sie lernen, wie Sie PBC frühzeitig erkennen, die Progression einschätzen und die Versorgung individuell optimieren können – auch bei unzureichendem Therapieansprechen.





Bereichsleitung Ernährungsmedizin, Oberärztin Medizinische Klinik 1 Hector-Center für Ernährung, Bewegung und Sport, Universitätsklinikum Erlangen
- Allgemeinmedizin / Gastroenterologie
Gluten-/Weizen-Sensitivität und Weizenallergie: Neue Empfehlungen zu Diagnose und therapeutischem Vorgehen
Gluten-/Weizen-Sensitivität und Weizenallergie: Neue Empfehlungen zu Diagnose und therapeutischem Vorgehen
Das Spektrum der Weizenunverträglichkeiten umfasst neben der Zöliakie und der Weizenallergie auch die Weizensensitivität, die als Non Celiac Wheat Sensitivity (NCWS) bezeichnet wird. Bei der NCWS handelt es sich um eine Störung mit intestinalen und extraintestinalen Symptomen, die nach dem Verzehr gluten- bzw. weizenhaltiger Nahrungsmittel bei Patienten auftreten können. Ein multifaktorielles Geschehen wird als Auslöser diskutiert.
Neben den vielfältigen Symptomen der NCWS werden in dieser Fortbildung auch die Unterschiede zur Zöliakie und einer Weizenallergie aufgezeigt. Erfahren Sie mehr über die aktuelle Studienlage der NCWS und gewinnen Sie einen umfangreichen Einblick in die aktuellen Diagnose- und Therapieempfehlungen.