Aktuelle CME
Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.





Apl.-Professur Charité – Universitätsmedizin Berlin
Internist und Nephrologe, Hypertensiologe DHL®, Lipidologe DGFF®
Chefarzt Klinik für Innere Medizin
Akademisches Lehrkrankenhaus der „HMU Health and Medical University“, Potsdam
- Nephrologie / Kardiologie / Innere Medizin
Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag
Wenn Hypertonie zur Nierensache wird - Diagnostik und Therapie im Praxisalltag
Die arterielle Hypertonie ist nicht nur eine kardiovaskuläre Erkrankung, sondern stellt insbesondere im Kontext der chronischen Nierenkrankheit eine besondere diagnostische und therapeutische Herausforderung dar. In dieser Fortbildung geben Herr Prof. Tölle und Herr PD Dr. Zickler praxisnahe Einblicke in die strukturierte Diagnostik, Differenzialdiagnosen und zeitgemäße Therapieansätze bei Hypertonie mit Fokus auf Patienten mit chronischer Nierenkrankheit. Der Vortrag verknüpft pathophysiologische Grundlagen mit Leitlinienwissen und klinischer Erfahrung und zeigt auf, wie sich diese im nephrologischen Praxis- und Klinikalltag sicher anwenden lassen. Ein anschließender Expertenaustausch greift zentrale Fragestellungen auf und rundet die Fortbildung mit einer praxisnahen Einordnung aktueller Aspekte ab.



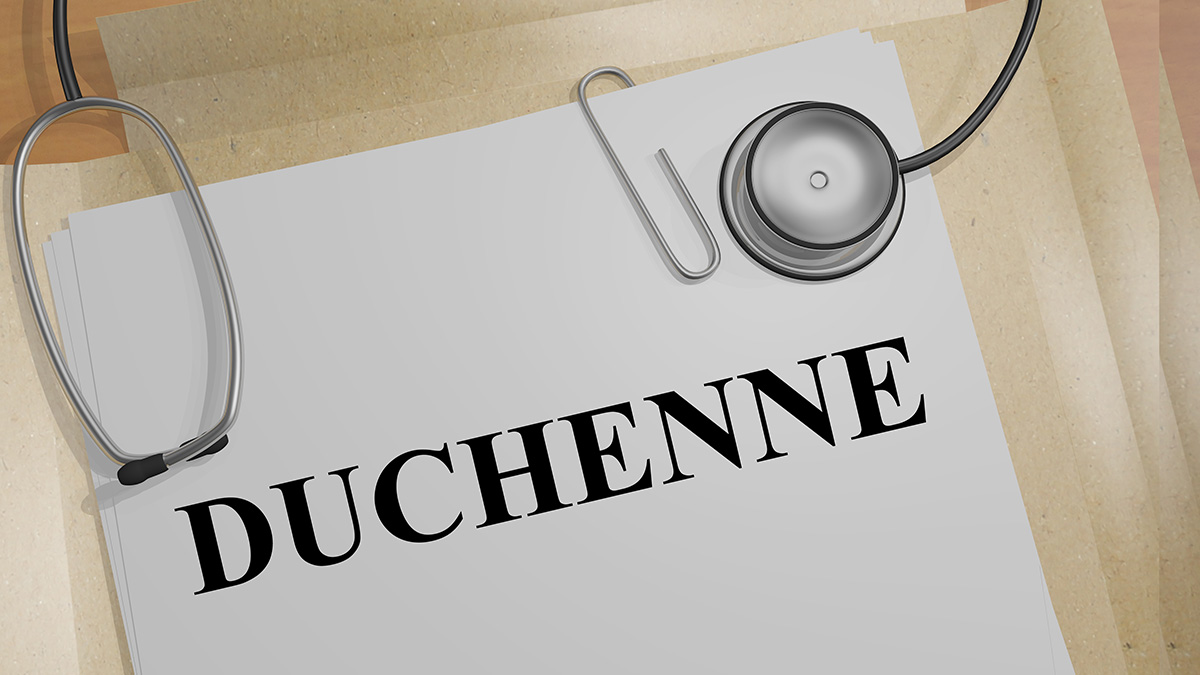

Oberarzt (Sektion Neuropädiatrie und Stoffwechselmedizin)
Ärztliche Leitung (paedKliPS (Pädiatrisches Klinisch-Pharmakologisches Studienzentrum))
Projektleitung (INTEGRATE-ATMP)
Universitätsklinikum Heidelberg
- Kinder- und Jugendmedizin / Neurologie / Kardiologie / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie
Duchenne Muskeldystrophie
Duchenne Muskeldystrophie
Diese eCME führt strukturiert in die Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) ein und beleuchtet die Pathophysiologie weit über den klassischen Membrandefekt hinaus. Anhand aktueller wissenschaftlicher Daten werden zentrale Mechanismen wie gestörte Calciumhomöostase, mitochondriale Dysfunktion, Veränderungen der NO-Signalwege, epigenetische Regulation durch HDAC-Aktivität sowie die Rolle von Satellitenzellen, FAP-Zellen und Immunzellen verständlich dargestellt. Ergänzend bietet das Modul einen Überblick über etablierte und neue Therapieansätze, inklusive genetischer und epigenetischer Strategien, sowie über den Einfluss dieser Behandlungen auf Funktion, Progression und Lebensqualität von DMD-Patienten.





Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie / Hypertensiologie DHL®
Nierenzentrum Wiesbaden
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Nephrologie / Kardiologie
Sicherer Umgang mit Hypertonie in der Hausarztpraxis - Was empfehlen die Leitlinien?
Sicherer Umgang mit Hypertonie in der Hausarztpraxis - Was empfehlen die Leitlinien?
Bluthochdruck ist nach wie vor die führende Todesursache weltweit – und häufig unzureichend kontrolliert. In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie sich die Empfehlungen der aktuellen Hypertonie-Leitlinien sinnvoll und praxisnah in den Alltag der Hausarztpraxis übertragen lassen.
Herr Prof. Vonend gibt Orientierung zu Zielwerten sowie zu medikamentösen und nicht-medikamentösen Maßnahmen und teilt seine Erfahrungen aus der klinischen Praxis. Er zeigt, worauf es in der praktischen Umsetzung wirklich ankommt – von der Diagnostik bis zum langfristigen Management –, um die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit Hypertonie sicher, nachvollziehbar und wirksam zu gestalten.





stellvertr. ärztlicher Direktor und Leiter des Instituts für Cardiomyopathien Heidelberg, Universitätsklinikum Heidelberg
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie / Nuklearmedizin
Kardiale Amyloidose: Verdacht und erste Schritte
Kardiale Amyloidose: Verdacht und erste Schritte
Bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die unter Luftnot, Schwindel sowie mangelnder Belastbarkeit leiden und nicht auf die Standardtherapie bei Herzinsuffizienz ansprechen, kann eine kardiale Amyloidose wie die Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM) zugrunde liegen. Insbesondere ältere Patient:innen sind davon betroffen und die Diagnose erfolgt häufig, aufgrund der Heterogenität der Symptome, sehr spät.
Im Fokus dieser Fortbildung stehen die Besonderheiten des Krankheitsbildes der kardialen Amyloidose. Ein interdisziplinäres Expertenteam diskutiert ihre Erfahrungen und verdeutlicht praxisnah die Vorgehensweise bei Verdacht einer kardialen Amyloidose bis hin zur Diagnose. Red Flags der ATTR-CM, wichtige Hinweise zur Differentialdiagnose und die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit werden vorgestellt und diskutiert. Zur Veranschaulichung der diagnostischen Elemente dienen Einspieler der teilnehmenden Fachärzte sowie ausgewählte Beiträge verschiedener Universitätszentren. Des Weiteren schildert ein betroffener Patient seine Krankengeschichte.





Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin, Professor für Kardiologie an der Universität Leipzig, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig.
- Allgemeinmedizin / Angiologie / Innere Medizin / Kardiologie
Grundlagen der Lipidtherapie
Grundlagen der Lipidtherapie
Kardiovaskuläre Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Dabei zählt die Hypercholesterinämie zu den größten Risikofaktoren für die Entstehung von Atherosklerose und für die Pathogenese kardiovaskulärer Erkrankungen. Im Rahmen dieser Fortbildung werden die Grundlagen der Lipidtherapie ausführlich besprochen sowie die der Pathogenese atherosklerotischer Erkrankungen zugrundeliegenden Lipoproteine. Insbesondere wird auf die Bedeutung des LDL-C-Cholesterins eingegangen. Zudem werden die verschiedenen Therapieoptionen zur Senkung des LDL-Cholesterins diskutiert. Dabei finden bewährte Medikamente, neue Wirkstoffe sowie Empfehlungen aktueller Leitlinien Berücksichtigung.





Oberärztin, Leitung Lipoproteinapherese, Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin,
Arbeitsbereich Lipidstoffwechsel, Charité – Universitätsmedizin Berlin
- Kardiologie / Angiologie / Allgemeinmedizin
Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko
Familiäre Hypercholesterinämie (FH) - Grundlagen und kardiovaskuläres Risiko
Die familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist eine häufige, stark unterdiagnostizierte genetisch bedingte Fettstoffwechselstörung. Aufgrund von lebenslang erhöhten LDL-C-Werten haben FH-Patienten ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Frau Dr. Kassner einen kompakten und praxisorientierten Überblick zu den Grundlagen der FH. Sie erfahren das Wichtigste zur Epidemiologie, zur klinischen Präsentation und zur Diagnostik samt Kaskadenscreening und der Anwendung etablierter Diagnose-Scores. Darüber hinaus werden die aktuellen Therapieziele und Behandlungsoptionen für heterozygote und homozygote FH leitliniengerecht besprochen. Die wichtigsten Lernziele sind, die diagnostischen Kriterien sicher anzuwenden, das individuelle kardiovaskuläre Risiko der FH-Patienten richtig einzuordnen und die Bedeutung frühzeitiger sowie konsequent lipidsenkender Strategien für die langfristige Prognose zu verstehen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen zur häufigsten monogenetischen Erkrankung mit einem hohen kardiovaskulären Risiko für die Patienten aufzufrischen.





Facharzt für Innere Medizin/Kardiologie,
Praxis für Prävention und kardiovaskuläre Medizin,
Essen
- Kardiologie / Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin
Risikoadaptierte Lipidtherapie
Risikoadaptierte Lipidtherapie
Diese Fortbildung vermittelt eine praxisorientierte Übersicht zur risikoadaptierten Lipidtherapie gemäß den ESC/EAS-Leitlinien. Sie vermittelt praxisnahe Ansätze zur Identifikation von Patienten mit hohem und sehr hohem kardiovaskulärem Risiko. Dabei werden effektive Strategien zur schnellen Zielverwirklichung von LDL-Zielwerten aufgezeigt, angefangen bei Lebensstilmodifikationen bis hin zu innovativen medikamentösen Therapien. Ziel ist es, bei Hochrisikopatienten durch enge Kontrollen und rasche Anpassungen die Zielwerte schnell zu erreichen und so das Risiko zu reduzieren.



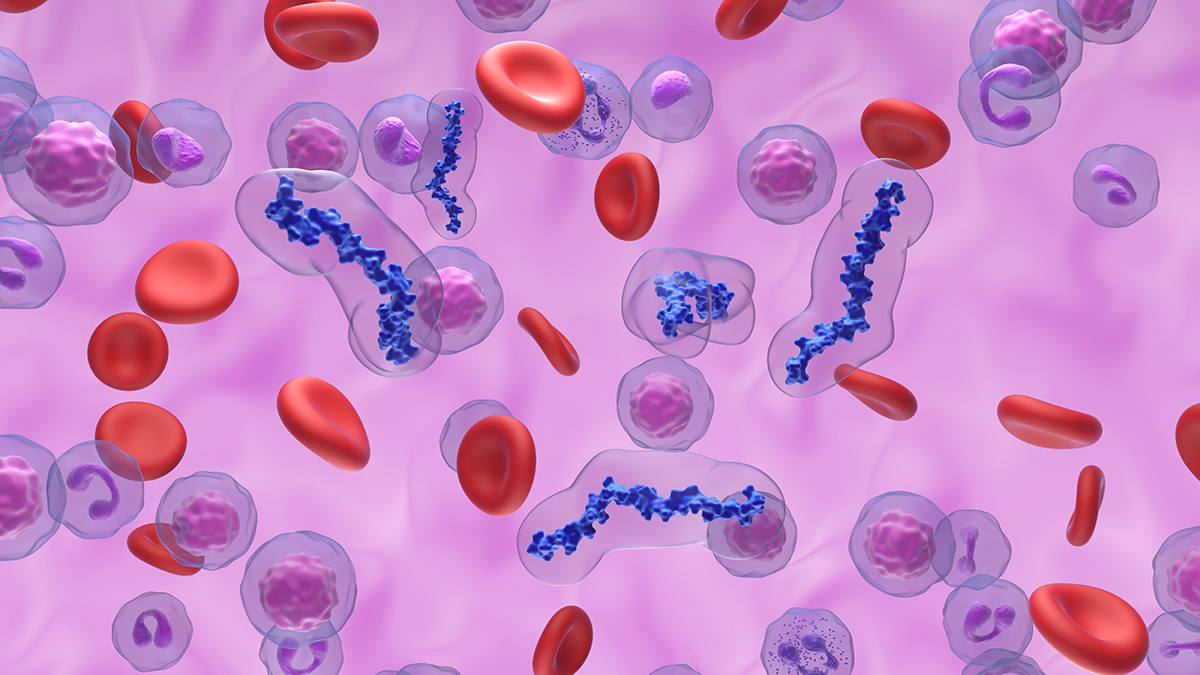

Facharzt für Innere Medizin und Angiologie,
Phlebologie, Diabetologie, Hämostaseologie
CCB Gefäß Centrum
- Angiologie / Kardiologie / Innere Medizin / Nephrologie
Niere und niedermolekulare Heparine
Niere und niedermolekulare Heparine
Das Krankheitsbild der chronischen Nierenkrankheit birgt ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Komplikationen. Diese Fortbildung vermittelt praxisorientiertes Wissen zur sicheren Anwendung von NMH bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, einschließlich evidenzbasierter Leitlinien und individueller Anpassung zur Thromboseprophylaxe. Dabei steht die Risikoabschätzung für Blutungen und Thrombosen im Vordergrund sowie die Bedeutung der optimalen Dosierung und Monitoring-Strategien. Diese Inhalte fördern die sichere und effektive Behandlung von nierenkranken Patienten und laden zur Vertiefung ein, um das Wissen in der täglichen Praxis anzuwenden.





Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie
Direktorin des Krukenberg-Krebszentrums Halle (KKH)
Oberärztin Universitätsklinik und Poliklinik für Innere Medizin IV
Universitätsklinikum Halle (Saale)
- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie
Polycythaemia Vera und kardiovaskuläres Risiko
Polycythaemia Vera und kardiovaskuläres Risiko
Polycythaemia Vera (PV) ist eine seltene bösartige hämatoonkologische Erkrankung, die überwiegend ältere Patienten betrifft und durch kardiovaskuläre Komplikationen tödlich verlaufen kann.
Im Rahmen dieser eCME beleuchten Frau Prof. Al-Ali und Herr Prof. Hagendorff die PV jeweils aus hämatologischer und kardiologischer Sicht und stellen dabei heraus, inwiefern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den beiden Fachgebieten für die Betreuung von PV-Patienten von äußerster Bedeutung ist. Frau Prof. Al-Ali führt zunächst in die PV ein und stellt die wichtigsten Risikofaktoren sowie deren differenzierte Gewichtung - auch im Hinblick auf eine adäquate Therapie - vor. Herr Prof. Hagendorf stellt anschließend Standards zur Beurteilung des kardiovaskulären Risikos bei PV-Patienten vor. Er legt dabei besonderes Augenmerk auf die Echokardiographie als Screening-Verfahren und stellt diese anhand ausgewählter Aufnahmen näher vor. Abschließend diskutieren beide Referenten, wie der fachübergreifende Austausch nach Ihrer Erfahrung am besten gepflegt und gefördert werden kann, um eine optimale Betreuung von PV-Patienten gewährleisten zu können.





FESC, FACC, FSCMR
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Gendermediziner
Chefarzt Medizinische Klinik I, Gender-Herz-Zentrum (GHZ)
Sana-Klinikum Remscheid GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu Köln
- Kardiologie / Innere Medizin
Geschlechtsspezifische Medizin in der Kardiologie
Geschlechtsspezifische Medizin in der Kardiologie
Die Gendermedizin beschäftigt sich mit den Unterschieden in den Symptomen und Ausprägungen von Krankheiten bei Frauen und Männern. Lernen Sie in dieser CME die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei kardiologischen Erkrankungen u.a. hinsichtlich Pharmakokinetik, Risikofaktoren, Diagnostik sowie Therapie kennen.
Erfahren Sie von Herrn Prof. Sievers, Gendermediziner und Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, warum er - neben der leitliniengerechten Behandlung - auch für eine geschlechtersensible Behandlung plädiert. Anhand von Fallbeispielen erläutert Herr Prof. Sievers mit Bild- und Videomaterial anschaulich die frauenspezifischen Besonderheiten bei verschiedenen kardiologischen Erkrankungen wie z.B. Herzinsuffizienz oder bei Herzinfarkt. Am Ende dieser Fortbildung wissen Sie, worauf Sie in Ihrem Praxisalltag achten sollten, um zusätzlich zur leitliniengerechten Betreuung eine geschlechtersensible Medizin anwenden zu können.





Chefarzt der Abteilung für Allgemeine Inneren Medizin und Nephrologie
Robert Bosch Krankenhaus, Stuttgart
- Nephrologie / Innere Medizin / Chirurgie - Herzchirurgie / Kardiologie / Intensivmedizin
Schnittstelle Nephrologie und Herzchirurgie: Die akute Nierenschädigung (AKI) im Fokus
Schnittstelle Nephrologie und Herzchirurgie: Die akute Nierenschädigung (AKI) im Fokus
Bei dieser interdisziplinären Fortbildung beleuchten Herr Prof. Dr. Jörg Latus und Frau PD Dr. Nora Göbel die akute Nierenschädigung (akute Nierenfunktionseinschränkung, AKI), die mit längerer Hospitalisierung und erhöhter Mortalität einhergeht, aus den Blickwinkeln der Nephrologie und der Herzchirurgie.
Die akute Nierenschädigung tritt häufiger auf als man denkt! Doch wie hoch ist ihre Inzidenz wirklich? Wie wird die AKI kodiert, wie beeinflusst sie das Patienten-Outcome und welche ökonomischen Folgen können entstehen? Das besondere Augenmerk ist dabei auf die akute Nierenschädigung im Zusammenhang mit herzchirurgischen Eingriffen, auch bekannt als CSA-AKI, gerichtet. In dieser CME erfahren Sie, wie die Nierenfunktion in der Herzchirurgie beeinflusst werden kann. Zudem lernen Sie AKI-Risikofaktoren und deren Abschätzung mithilfe von Scores sowie Maßnahmen zur Prävention und Risikominimierung kennen. Die beiden Expert:innen vermitteln praxisnah, wie wichtig dabei die interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Schnittstelle zwischen Nephrologie und Herzchirurgie ist.





Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie
Oberärztin, Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin (Med. Klinik I), Universitätsklinikum Aachen
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie / Kardiologie
Kardiovaskuläre und -renale Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes - Vorbeugung, Behandlung und Sofortmaßnahmen
Kardiovaskuläre und -renale Erkrankungen bei Patienten mit Diabetes - Vorbeugung, Behandlung und Sofortmaßnahmen
Diabetes mellitus Typ 2 ist längst keine reine Stoffwechselerkrankung mehr, sondern ein zentrales Risiko für schwerwiegende kardiovaskuläre und renale Folgeerkrankungen. Diese Fortbildung zeigt praxisnah, wie Ärztinnen und Ärzte das individuelle Risiko frühzeitig erkennen und die aktuellen ESC-Leitlinien 2023 zur Prävention und Behandlung konsequent umsetzen können. Neben der Einführung in das neue Risikobewertungssystem SCORE2-Diabetes werden Strategien zur Lebensstiländerung, evidenzbasierte pharmakologische Ansätze und das Management von Begleiterkrankungen wie Herzinsuffizienz und chronischer Nierenerkrankung vorgestellt. Ein besonderer Fokus liegt auf der hausärztlichen Umsetzung, der Bedeutung regelmäßiger Kontrolluntersuchungen und der interdisziplinären Zusammenarbeit zur Vermeidung von Folgeschäden.
Die Teilnehmenden lernen, wie sie das kardiovaskuläre Risiko bei Menschen mit Diabetes systematisch einschätzen, Leitlinienempfehlungen individualisiert anwenden und Präventionsstrategien effektiv in den Praxisalltag integrieren können.



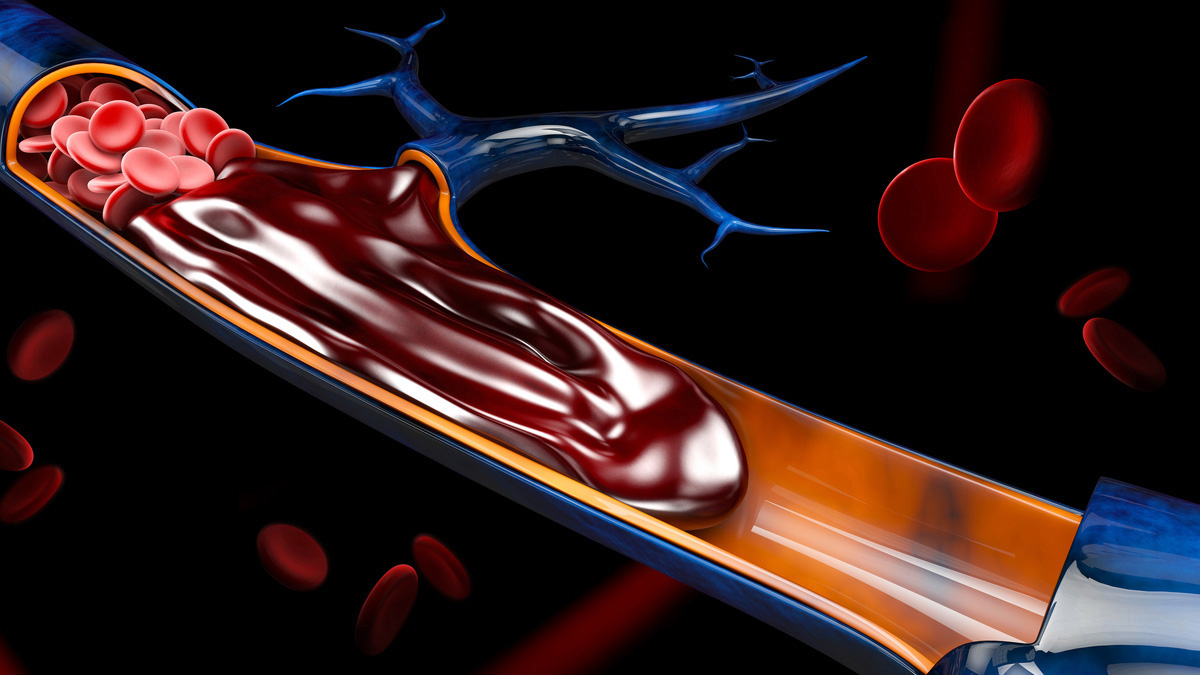

Facharzt für Angiologie, Innere Medizin und Kardiologie, Lipidologe
HUGG-Herz- und Gefäßmedizin Goslar
- Angiologie / Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Kardiologie
Verlängerte Erhaltungstherapie und mögliche Komplikationen der venösen Thromboembolie bei Erwachsenen
Verlängerte Erhaltungstherapie und mögliche Komplikationen der venösen Thromboembolie bei Erwachsenen
Bei einer venösen Thromboembolie (VTE) ist eine Antikoagulation für 3–6 Monate erforderlich, um das Wachstum des Thrombus zu stoppen. Allerdings bleibt nach einer überstandenen VTE das Risiko eines Rezidivs sowie die Möglichkeit von Langzeitkomplikationen wie dem postthrombotischen Syndrom (PTS) und der chronisch thromboembolischen pulmonalen Hypertonie (CTEPH) bestehen.
Eine individuelle Einschätzung des VTE-Rezidivrisikos ist für die Erwägung einer verlängerten Erhaltungstherapie entscheidend. In diesem zertifizierten Fortbildungsprogramm werden die Risikofaktoren für ein VTE-Rezidiv, die Abwägung von Nutzen und Risiken einer verlängerten Antikoagulationstherapie sowie die potenziellen Gefahren eines PTS oder einer CTEPH näher erläutert.





Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Oberarzt HELIOS Klinikum Berlin Buch,
Arbeitsgruppenleiter: ECRC (Experimental and Clinical Research Center),
Charité, Campus Buch und Max-Delbrück-Centrum, Berlin
- Kardiologie / Innere Medizin / Allgemeinmedizin
Schwer einstellbare Hypertonie & Herzinsuffizienz: Von der Leitlinie in den Alltag
Schwer einstellbare Hypertonie & Herzinsuffizienz: Von der Leitlinie in den Alltag
Bluthochdruck und Herzinsuffizienz gehören zu den häufigsten kardiovaskulären Herausforderungen im Praxisalltag. In dieser CME beleuchten Prof. Ralf Dechend und Prof. Fabian Knebel die enge Verzahnung beider Erkrankungen anhand aktueller Leitlinien (ESC/ESH) und praxisnaher Fallbeispiele. Herr Prof. Dechend fokussiert sich im ersten Teil auf die schwer einstellbare Hypertonie mit leitliniengerechter Medikation sowie neuen Therapieansätzen. Im zweiten Teil beleuchtet Herr Prof. Knebel die Definition der Herzinsuffizienz über das gesamte Spektrum der EF, die pathophysiologischen Besonderheiten der HFpEF, Diagnostik sowie evidenzbasierte Therapieoptionen. Der Expertendialog liefert konkret umsetzbare Handlungsempfehlungen zur differenzialdiagnostischen Einordnung und sinnvoller Medikamentenkombinationen, verbindet Theorie und klinische Praxis und bietet wertvolle Orientierung für die tägliche Versorgung von Patienten mit kardiovaskulären Risikokonstellationen.





Ärztin für Allgemeinmedizin, Ernährungsmedizin & Sportmedizin
Diplom Sportwissenschaftlerin
- Allgemeinmedizin / Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin / Kardiologie
Magnesiummangel im Praxisalltag: Von Muskelkrampf bis Stress
Magnesiummangel im Praxisalltag: Von Muskelkrampf bis Stress
Ein Magnesiummangel zählt zu den häufigeren, aber oft übersehenen Problemen in der allgemeinärztlichen Praxis. Patienten klagen nicht nur über Muskelkrämpfe – das wohl bekannteste Symptom. Die gesundheitlichen Folgen eines Mangels reichen deutlich weiter. Der Mineralstoff spielt eine zentrale Rolle bei Stressverarbeitung und Schlafqualität – Aspekte, die im Praxisalltag zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus besteht ein Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dem metabolischen Syndrom oder Osteoporose. Daher gilt es, einen Magnesiummangel frühzeitig zu erkennen und gezielt zu behandeln. Teilnehmende lernen, Magnesiummangel als mögliche Ursache vielfältiger Beschwerden zu erkennen, Risikogruppen gezielt zu identifizieren und die wichtigsten diagnostischen und therapeutischen Schritte umzusetzen.





Kardiologe und Facharzt für Innere Medizin
Kardiologie am Tibarg, Hamburg
- Kardiologie / Innere Medizin
Diagnostik und Therapie der kardialen Transthyretin-Amyloidose
Diagnostik und Therapie der kardialen Transthyretin-Amyloidose
Dieses CME vermittelt in zwölf kurzen praxisorientierten Kapiteln Wissen zur Entstehung, Diagnose und Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM). Schwerpunkte legen Dr. Fabian Stahl, Hamburg, und Prof. Dr. Herbert Nägele, Leiter des Departement Herzinsuffizienz und Devicetherapie Albertinen-Krankenhaus, Hamburg, auf die Warnzeichen, die Red Flags, die den Verdacht auf die Erkrankung lenken, und die Diagnose. Vertiefende Informationen gibt es zum Stellenwert der Echokardiographie und der Skelettszintigraphie bei der Diagnose und zur Bedeutung des Zusammenspiels von hausärztlicher, kardiologischer und nuklearmedizinischer Praxis, um Patient:innen frühzeitig zu diagnostizieren und kausal zu therapieren.





Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie
Onkologicum HOPA MVZ GmbH, Hamburg
- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin
AL-Amyloidose - Fokus Patientenfälle
AL-Amyloidose - Fokus Patientenfälle
Die AL-Amyloidose ist eine seltene, jedoch hochrelevante Systemerkrankung, die durch Ablagerungen fehlgefalteter Proteine zu fortschreitenden Organschädigungen – vor allem an Herz und Niere – führt. Diese Fortbildung stellt anhand anschaulicher Patientenfälle die klinische Vielfalt dar, zeigt praxisnahe Strategien zur Differenzialdiagnose gegenüber anderen Amyloidoseformen auf und beleuchtet die prognostische Bedeutung von Biomarkern sowie Organbefall. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Studiendaten, deren Bedeutung für Organansprechen und Langzeitprognose, sowie die Empfehlungen der aktuellen Onkopedia-Leitlinie, die eine klare Orientierung für Diagnostik und Therapieentscheidungen geben.
Ziel dieser Fortbildung ist es, Warnsignale frühzeitig zu erkennen, diagnostische Algorithmen gezielt einzusetzen und das individuelle Risiko anhand validierter Scores sicher einzuschätzen. Darüber hinaus erfahren sie, wie sich aktuelle Studienergebnisse und Leitlinienempfehlungen unmittelbar in die klinische Praxis übertragen lassen, um Patientinnen und Patienten auch in komplexen Situationen leitliniengerecht und effektiv zu versorgen. Diese Fortbildung vermittelt kompaktes, praxisrelevantes Wissen und lädt ein, die eigene Handlungssicherheit im Management dieser herausfordernden Erkrankung weiter zu stärken.





Fellow of the Royal Society of Medicine, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologe, Diabetologe, Androloge, Sexualmediziner (FECSM), Geschäftsführender Oberarzt am Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie, Universitätsklinikum Münster, Klinischer Androloge der Europäischen Akademie für Andrologie (EAA)
- Innere Medizin / Urologie / Endokrinologie und Diabetologie / Kardiologie
Testosterontherapie und kardiovaskuläres Risiko
Testosterontherapie und kardiovaskuläres Risiko
Studien konnten zeigen, dass das Auftreten von kardiovaskulären (CV) Erkrankungen bzw. CV-Ereignissen bei Männern u.a. von der Höhe des Testosteronspiegels abhängig ist. In der Vergangenheit wurden sowohl die positiven Wirkungen als auch mögliche Risiken einer Testosterontherapie (TTh) in Bezug auf unerwünschte CV-Ereignisse diskutiert. Eine Metaanalyse zeigt, dass nicht nur zu hohe, sondern auch zu niedrige Testosteronspiegel mit einer erhöhten Mortalität assoziiert sind. Seit 2023 stehen die Daten der TRAVERSE-Studie zur Verfügung. In dieser placebokontrollierten klinischen Studie wurde die CV-Sicherheit einer TTh an rund 5.200 Männern über mehr als 4 Jahre untersucht. Prof. Michael Zitzmann aus Münster erläutert in dieser Fortbildung die aktuelle Datenlage zu diesem Thema und erklärt, warum individualisierte Strategien sowie regelmäßige Kontrollen im Rahmen einer TTh wichtig sind.