

UNTERSTÜTZT DIESE CME:





Leitender Oberarzt, LMU Klinikum, Medizinische Klinik und Poliklinik V, Pneumologie/Thorakale Onkologie, Thoracic Oncology Centre Munich (TOM), Netzwerkkoordinator des Lungentumorzentrums München
- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Neue S3-Leitlinie: Aktuelle und zukünftige Therapien beim fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC)
Neue S3-Leitlinie: Aktuelle und zukünftige Therapien beim fortgeschrittenen kleinzelligen Lungenkarzinom (SCLC)
Das kleinzellige Lungenkarzinom (SCLC) ist ein hoch aggressiver Tumor mit schnellem Wachstum und früher Metastasierung. Bereits bei Diagnosestellung befinden sich viele Patienten im fortgeschrittenen Stadium, die Prognose ist nach wie vor sehr schlecht. In dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn PD Dr. Kauffmann-Guerrero einen praxisnahen Überblick der Empfehlungen zum SCLC der kürzlich aktualisierten S3-Leitlinie Lungenkarzinom. Ein Fokus liegt dabei auf den aktuellen Therapiestandards bei SCLC-Patienten in lokal fortgeschrittenen und metastasierten Stadien. Da die Zweitlinienoptionen bezüglich Wirksamkeit und Verträglichkeit limitiert sind, erhalten Sie zudem wertvolle Informationen zu neuen Therapieoptionen wie beispielweise Antikörper-Drug-Konjugate und T-Zell-Engager. Neben den aktuellen Leitlinien-Empfehlungen finden die neuesten Studiendaten vom ASCO 2025 Berücksichtigung. Diese Fortbildung bietet Ihnen fundiertes Wissen auf dem aktuellen Stand und unterstützt Sie dabei, SCLC-Patienten auf höchstem Niveau leitlinienkonform und zukunftsorientiert zu versorgen.





Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderhämatologie und –Onkologie, Direktor der Klinik für Kinderonkologie und -rheumatologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
- Hämatologie und Onkologie / Kinder- und Jugendmedizin
First-line Therapie der Akuten Lymphoblastischen Leukämie (ALL) im Kindes- und Jugendalter
First-line Therapie der Akuten Lymphoblastischen Leukämie (ALL) im Kindes- und Jugendalter
Die akute lymphoblastische Leukämie (ALL) ist die häufigste maligne Erkrankung im Kindes- und Jugendalter. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Cario einen Einblick in die aktuelle Erstlinientherapie bei pädiatrischen Patienten mit ALL und bespricht die Therapieoptimierung samt Herausforderungen wie beispielsweise Langzeitfolgen oder die Vermeidung von Rezidiven. Zentrale Themen sind die Risikostratifizierung, die für die optimale Therapieentscheidung essenziell ist, sowie die neuesten Erkenntnisse zur Behandlung von Hochrisikopatienten, insbesondere Säuglingen mit KMT2A-Rearrangement und Patienten mit schwerer Toxizität. Darüber hinaus wird die Reduktion der Therapieintensität für Kinder mit exzellenten Heilungschancen diskutiert sowie die frühzeitige Integration einer Immuntherapie im Kontext aktueller Studien beleuchtet. Diese Fortbildung bietet Ihnen fundiertes Wissen und praxisrelevante Empfehlungen zur individuellen Behandlung der pädiatrischen ALL.



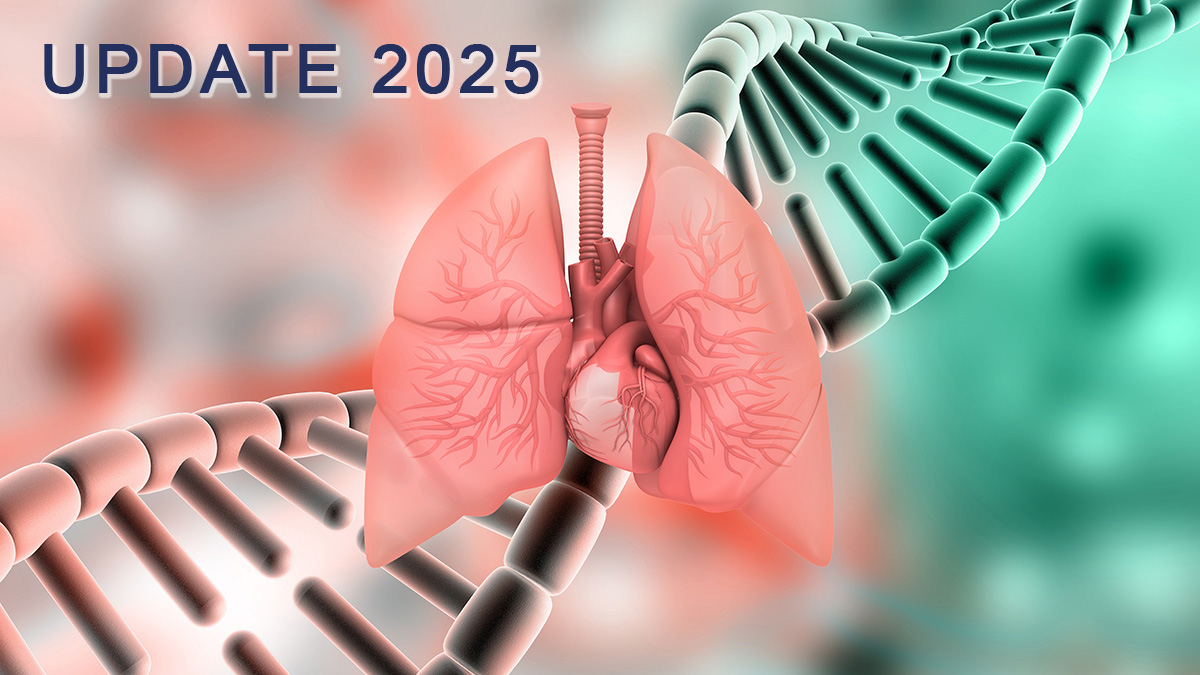

Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie,
Chefärztin, Innere Medizin I, St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig
- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
NSCLC: Therapierbare genetische Alterationen - Neue Leitlinien 2025
NSCLC: Therapierbare genetische Alterationen - Neue Leitlinien 2025
Lungenkarzinome gehören zu den häufigsten malignen Tumoren. Der Anteil nicht-kleinzelliger Lungenkarzinome (NSCLC) beträgt ca. 80 - 85 % und die Diagnosestellung erfolgt meist in fortgeschrittenen oder metastasierten Stadien. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Frau Dr. Gütz als Autorin der kürzlich erschienenen Leitlinien die Empfehlungen dieser zur Therapie des NSCLC im Stadium IV vor. Der besondere Fokus liegt dabei auf den therapierbaren genetischen Alterationen wie unter anderem EGFR-Mutationen, ALK-Fusionen, BRAF-V600-E-Mutation und KRAS-G12C-Mutation. Neben den Leitlinien-Empfehlungen inklusive Therapie-Algorithmen erfahren Sie dabei kurz und prägnant das Wichtigste zu den relevanten Studiendaten.



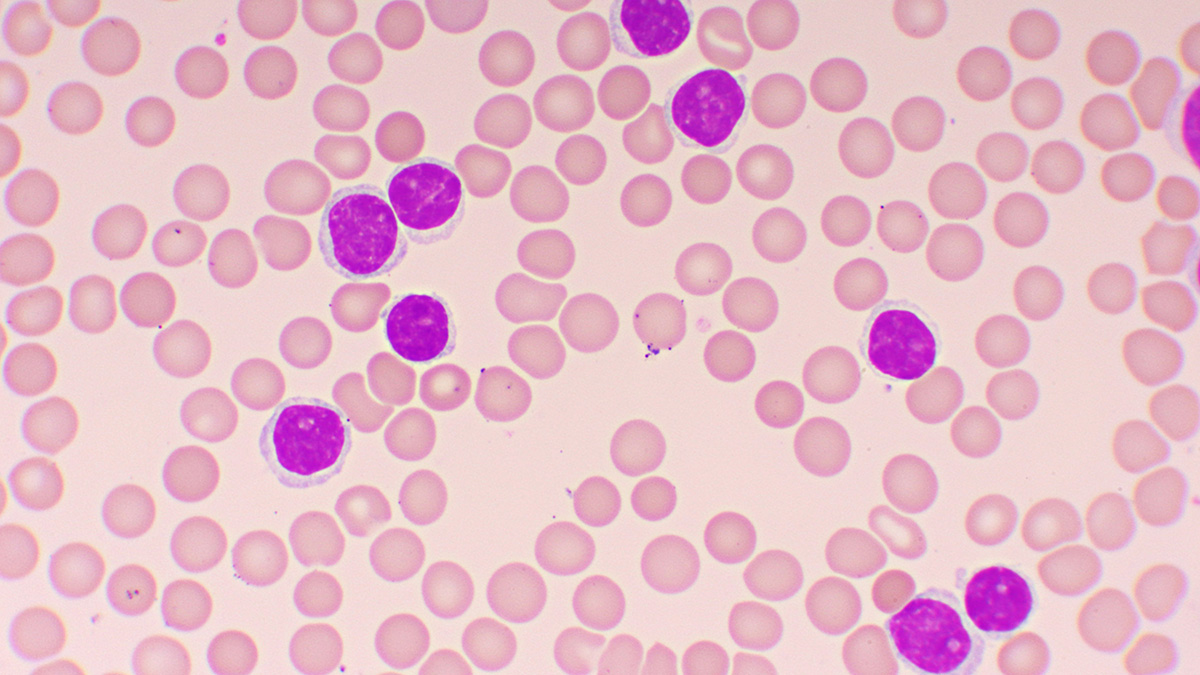

Leitung der Studienzentrale der Medizinischen Klinik II,
Oberärztin, Universitätsmedizin Frankfurt
- Hämatologie und Onkologie
Erstlinientherapie der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) des Erwachsenen
Erstlinientherapie der akuten lymphatischen Leukämie (ALL) des Erwachsenen
Diese Fortbildung richtet sich besonders an Fachärzte für Hämatologie und Onkologie. Die akute lymphatische Leukämie (ALL) des Erwachsenen stellt eine komplexe, heterogene Erkrankung dar, deren Behandlung in den letzten Jahren maßgeblich verbessert wurde. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Frau Dr. Gökbuget in einem spannenden Vortrag einen umfassenden Überblick über aktuelle Strategien der Erstlinientherapie der ALL bei Erwachsenen. Dabei finden unter anderem alters- und risikoadaptierter Ansätze, innovative GMALL-Studienprotokolle sowie neue Entwicklungen in der Immuntherapie Berücksichtigung. Sie erhalten zudem wertvolle Informationen zur Diagnostik, Risikostratifizierung und Nachsorge bei ALL-Patienten sowie zur ZNS Prophylaxe, Therapie der T-ALL/LBL und Stammzelltransplantation. Nutzen Sie diese Fortbildung, Ihr Wissen zu personalisierter Therapieplanung zu vertiefen und die Versorgung der Patienten weiter zu verbessern.





Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie, Onkologie, Hämostaseologie und Palliativmedizin; Oberärztin, Leitung der Erwachsenen-Hämophilieambulanz, Medizinische Klinik I, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus, Dresden
- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Therapie der ITP - Neue Leitlinie 2024
Therapie der ITP - Neue Leitlinie 2024
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine erworbene Thrombozytopenie, für die eine Autoimmunreaktion gegen Thrombozyten im Blut und gegen Megakaryozyten im Knochenmark ursächlich ist. Die Therapieindikation orientiert sich an der Blutungssymptomatik und patientenindividuellen Faktoren. Im Rahmen dieser Fortbildung stellt Frau Dr. Trautmann-Grill als Autorin von dieser die 2024 erschienene Leitlinie vor. Neben den wichtigsten Informationen zur Pathogenese, zu klinischen Manifestationen und zur Diagnose der ITP wird die Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie samt Notfallsituation diskutiert. Dabei werden praxisrelevante Empfehlungen zur Anwendung und zu Nebenwirkungen von Glukokortikoiden gegeben sowie die Therapie mit Thrombopoetin-Rezeptor-Agonisten (TRA) samt Absetzschema, die Behandlung mit einem Syk-Inhibitor und weitere Therapieoptionen besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Expertise zu vertiefen und die optimale Versorgung der Patienten zu gewährleisten.





Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, FESBGH;
Praxis für Innere Medizin, Münster
- Gastroenterologie / Innere Medizin / Chirurgie - Viszeralchirurgie
Morbus Crohn & Colitis ulcerosa: Therapie in 2025 - Fisteln und Stenosen, Kombinationstherapien und KI
Morbus Crohn & Colitis ulcerosa: Therapie in 2025 - Fisteln und Stenosen, Kombinationstherapien und KI
Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sind Erkrankungen, die mit chronischen Entzündungen des Verdauungstraktes einhergehen und darüber hinaus weitere Komplikationen verursachen können. Im Rahmen dieser praxisnahen Fortbildung beleuchtet Herr Prof. Dr. Bettenworth in einem spannenden Vortrag die diagnostischen und therapeutischen Ansätze bei Patienten mit einem fibrostenotischen oder fistulierenden Morbus Crohn. Zusätzlich zu den dabei besprochenen chirurgischen und medikamentösen Strategien erhalten Sie einen aktuellen Überblick zu den medikamentösen Therapieoptionen samt modernen Kombinationstherapien bei Patienten mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sowie zu den klinischen Einsatzmöglichkeiten künstlicher Intelligenz. Diese Fortbildung liefert wertvolle Impulse für eine individuelle Versorgung Ihrer Patienten - nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihr Wissen auf den neuesten Stand zu bringen.





Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, ZB Allergologie, ZB Immunologie, Stellv. Klinikdirektor, Leitender Oberarzt,
Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie / Kinder- und Jugendmedizin
Neues zur Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen
Neues zur Psoriasis bei Kindern und Jugendlichen
Psoriasis im Kindes- und Jugendalter stellt eine besondere Herausforderung dar, da diese Erkrankung in einer sensiblen Entwicklungsphase auftritt und langfristige Auswirkungen auf das körperliche und seelische Wohlbefinden haben kann. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Gerdes einen umfassenden Überblick über das klinische Bild der pädiatrischen Psoriasis samt typischen Prädilektionsstellen und bespricht relevante Komorbiditäten wie z. B. Übergewicht und psychische Belastungen sowie den Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen. Anhand eines praxisnahen Fallbeispiels sowie der aktuellen S2k-Leitlinie werden die möglichen Therapieoptionen besprochen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den zugelassenen Systemtherapien samt wertvollen Anwendungshinweisen. Diese Fortbildung dient dazu, betroffene Kinder und Jugendliche individuell und ganzheitlich zu betreuen und die Lebensqualität der jungen Patienten gezielt zu verbessern.





Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie;
Klinikdirektor, Klinik für Innere Medizin V mit dem Schwerpunkt Angiologie,
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel
- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie / Innere Medizin
Kardiales Management bei onkologischen Patienten
Kardiales Management bei onkologischen Patienten
Viele onkologische Patienten haben vorbestehende Risikofaktoren, eine genetische Prädisposition oder kardiovaskuläre Vorerkrankungen, die durch eine Krebserkrankung selbst und insbesondere deren Behandlung zu einem weiten Spektrum an Komplikationen im Herz-Kreislauf-System führen können. Infolgedessen können sich kardiovaskuläre Probleme wie arterielle Hypertonie, Herzinsuffizienz, Thrombosen oder auch eine kardiale Amyloidose oder Myokarditis entwickeln. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Müller einen Überblick über das kardiale Management bei onkologischen Patienten. Dabei werden ausgewählte spezifische Therapieverfahren besprochen und auf die Risikostratifizierung, das Monitoring der Behandlung sowie auf die Prophylaxe und die Therapie potenzieller kardiovaskulärer Nebenwirkungen eingegangen. Dies erfolgt in Anlehnung an die aktuellen ESC-Leitlinien zur Kardio-Onkologie. Zudem wird die Risikostratifizierung vor potenziell kardiotoxischer Therapie diskutiert und Empfehlungen zu Verlaufskontrollen sowie zur Langzeitüberwachung gegeben.





Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie,
Zusatzbezeichnung Schmerztherapie,
Oberärztin, Rheumazentrum Ruhrgebiet
am Marien Hospital, Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie
Therapieadhärenz bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis
Therapieadhärenz bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis
Die Psoriasis ist eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, die mit einer verstärkten Schuppung der Haut einhergeht. Im Krankheitsverlauf können zudem die Gelenke betroffen sein und eine Psoriasis-Arthritis kann sich entwickeln. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Frau Dr. Andreica die Therapieadhärenz bei Patienten mit Psoriasis und Psoriasis-Arthritis. Neben Einflussfaktoren und Möglichkeiten zur Messung der Adhärenz werden in einer ausführlichen Literaturrecherche die neuesten Real-World- und Studiendaten zur Therapieadhärenz von Biologika und oralen Wirkstoffen präsentiert. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der UPLIFT-Studie vorgestellt und Empfehlungen zur Bewertung und Optimierung der Therapieadhärenz gegeben.





Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten
Stv. Klinikdirektor, leitendender Oberarzt, Personaloberarzt
Universitätsklinikum Erlangen
- Haut- und Geschlechtskrankheiten / Rheumatologie
Limitierung von konventionellen Präparaten - Besondere Manifestationen bei Psoriasis
Limitierung von konventionellen Präparaten - Besondere Manifestationen bei Psoriasis
Bei der Psoriasis handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, bei der sowohl die Haut als auch die Gelenke betroffen sein können. Besondere Manifestationen und Lokalisationen können unter anderem die Kopfhaut, den Genitalbereich, Handflächen oder Fußsohlen umfassen und gehen mit verschiedenen Herausforderungen einher. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Herr Prof. Sticherling einen Überblick über die besonderen Herausforderungen und Manifestationen der Psoriasis sowie deren diagnostischen und therapeutischen Anforderungen. Es werden praxisrelevante Ansätze zur Einschätzung des Schweregrads und zur individuellen Therapieplanung vermittelt. Dabei wird vor allem auf die Psoriasis der Kopfhaut, auf die Genitalpsoriasis und auf die Nagel-Psoriasis eingegangen. Diese Fortbildung dient zur Vertiefung des Wissens über Diagnostik und evidenzbasierte Behandlungsstrategien, insbesondere bei schwer zu behandelnden Formen der Psoriasis, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.





Facharzt für Innere Medizin und Hämatogie und Onkologie,
Oberarzt, Klinik für Innere Medizin II,
Hämatologie und Internistische Onkologie,
Universitätsklinikum Jena
- Innere Medizin / Hämatologie und Onkologie
Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024
Neues zur Immunthrombozytopenie (ITP) - Steroidtherapie & Leitlinie 2024
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine erworbene Thrombozytopenie, die durch eine Autoimmunreaktion gegen Thrombozyten und Megakaryozyten verursacht wird. Im Rahmen dieser Fortbildung erhalten Sie von Herrn Dr. Stauch wertvolle Informationen zur Pathophysiologie, zum klinischen Bild, zur Diagnose sowie zu den aktuellen Therapieoptionen der ITP. Besonders im Fokus stehen die im August 2024 erschienene neue Leitlinie zur ITP sowie die Behandlung mit Kortikosteroiden. Die Steroidtherapie wird dabei samt leitliniengerechtem Einsatz, möglichen Nebenwirkungen wie Osteoporose, kardiovaskulären Komplikationen, Infektionen und Diabetes sowie Behandlungsrealität besprochen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihre Expertise zu vertiefen und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.





Geschäftsführender Oberarzt,
Klinik für diagnostische und interventionelle Radiologie,
Universitätsklinikum Ulm
- Innere Medizin / Gastroenterologie / Radiologie / Augenheilkunde / Rheumatologie
IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon
IgG4-assoziierte Erkrankung - ein differentialdiagnostisches Chamäleon
Die IgG4-assoziierte Erkrankung (IgG4-RD) ist eine immunologische Systemerkrankung, die verschiedene Organe wie z. B. Pankreas, Gallenwege, Speichel- und Tränendrüsen, Nieren oder Aorta befallen kann. Die IgG4-RD ist differenzialdiagnostisch sehr komplex und wird in dieser Fortbildung von Herrn Prof. Kleger und Herrn Dr. Vogele in einem spannenden Austausch praxisnah anhand von Patientenkasuistiken besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zu den diagnostischen Kriterien und Bildgebungsmerkmalen und erhalten wertvolle Informationen, wie sich die IgG4-assoziierte Erkrankung von anderen Erkrankungen abgrenzen lässt. Es werden Grundlagen beispielsweise zur Pathogenese, zum klinischen Bild und zum Auftreten vermittelt sowie mögliche Therapieoptionen besprochen, um Rezidive und Organschäden zu verhindern. Diese Fortbildung bietet Basiswissen zur Diagnostik und Therapie von Patienten mit einer IgG4-RD und dient zur Weiterentwicklung der Expertise im Management dieser schwerwiegenden und differenzialdiagnostisch anspruchsvollen Erkrankung.





Fachärztin für Innere Medizin und Hämostaseologie,
Ärztliche Leitung,
MVZ Gerinnungszentrum Hochtaunus
- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Immunthrombozytopenie (ITP) - Empfehlungen zum Aufklärungsgespräch
Immunthrombozytopenie (ITP) - Empfehlungen zum Aufklärungsgespräch
Die Immunthrombozytopenie (ITP) ist eine Autoimmunerkrankung, die unter anderem durch eine immunologische Zerstörung der sonst normalen Thrombozyten charakterisiert ist. Die Patienten können unter Blutungssymptomen wie Petechien und Schleimhautblutungen leiden, aber auch unter Erschöpfungssymptomen, Müdigkeit/Fatigue bis hin zu depressiven Störungen. Im Rahmen dieser Fortbildung erfahren Sie das Wichtigste zur ITP wie z. B. klinisches Bild, Krankheitsverlauf, Pathophysiologie sowie Erst-, Zweit- und Drittlinientherapie und erhalten dazu wertvolle Empfehlungen zum Aufklärungsgespräch mit den ITP-Patienten. Ein besonderer Fokus wird zudem auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität sowie auf die Fatigue gelegt. Empfehlungen von der Fachpflege im Umgang mit Patienten wie z. B. Herausforderungen und Alltagstricks am Beispiel der Selbstapplikation runden diese Fortbildung ab.





Fachärztin für Augenheilkunde, FEBO
Oberärztin, Okuloplastische Chirurgie, Orbitachirurgie
Augenklinik der Universitätsmedizin Mainz
Augenklinik Dardenne, Bonn
- Augenheilkunde / Endokrinologie und Diabetologie / Allgemeinmedizin / Nuklearmedizin
Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) - Ein Überblick zum Krankheitsbild
Endokrine Orbitopathie (TED, thyroid eye disease) - Ein Überblick zum Krankheitsbild
Die Endokrine Orbitopathie (EO) ist eine Autoimmunerkrankung der Augenhöhle (Orbita), die im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenerkrankung auftreten kann. Aus diesem Grund ist die EO eine interdisziplinär relevante Erkrankung, die sowohl den Augenarzt als auch den Allgemeinmediziner und den Endokrinologen betrifft. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Prof. Ponto in einem spannenden Vortrag einen Überblick über das Krankheitsbild EO. Sie erfahren das Wichtigste zum Verständnis der Pathogenese sowie zum klinischen Bild und zur Beurteilung der EO samt Differenzierung der verschiedenen Schweregrade und Aktivitätsphasen inklusive Biomarker und Scoring-Tools wie CAS und VISA-Klassifikation. Sie erhalten wertvolle Informationen zum therapeutischen Management im Rahmen eines Fallbeispiels aus der Orbitasprechstunde und bekommen einen Einblick zur Lebensqualität und beruflichen Belastung der Patienten mit EO. Diese Fortbildung ist besonders relevant, um das interdisziplinäre Management der Erkrankung zu optimieren und die Lebensqualität der Patienten zu verbessern.



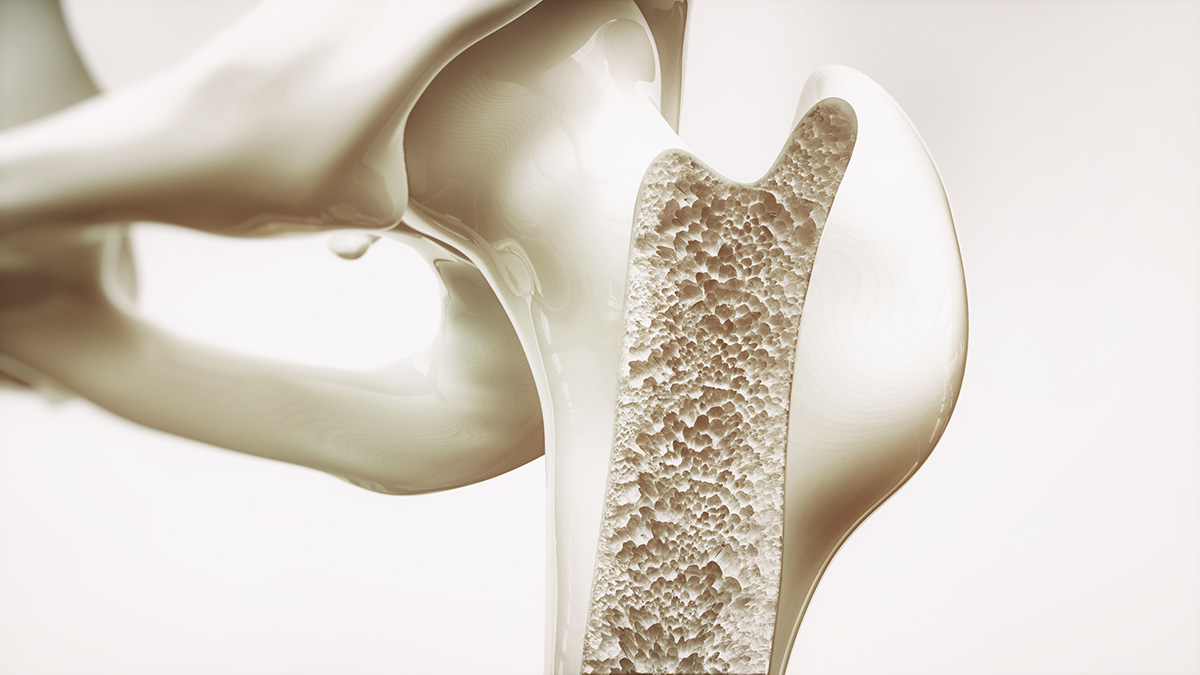

Leitung Klinische Osteologie Frankfurter Hormon & Osteoporosezentrum,
Vorsitzende der Leitlinienkommission des Dachverbandes Osteologie e.V.,
Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Osteologie
- Allgemeinmedizin / Innere Medizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie
Osteoporose - Kernempfehlungen der aktuellen Leitlinie
Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, die mit einem erhöhten Frakturrisiko einhergeht und durch Erkrankungen und Medikamente verursacht werden kann. Im Rahmen dieser Fortbildung gibt Frau Dr. Thomasius als Koordinatorin und Vorsitzende der Leitlinienkommission des DVO einen Überblick über die neu erschienene Leitlinie zur Osteoporose bei postmenopausalen Frauen und bei Männern ab dem 50. Lebensjahr. Sie erfahren das Wichtigste zu den Risikofaktoren und -indikatoren unter anderem aus der Endokrinologie, Neurologie und Rheumatologie aber auch zu allgemeinen Faktoren und Medikation. Im weiteren Verlauf der Fortbildung erhalten Sie Empfehlungen zur Basisdiagnostik bei Verdacht auf Vorliegen einer behandlungsbedürftigen Osteoporose inklusive DXA Messung, Labor und wann eine bildgebende Diagnostik sinnvoll ist. Zudem bespricht Frau Dr. Thomasius die Therapieschwellen und erläutert ausführlich die Bestimmung von diesen auch anhand eines Patientenbeispiels. Die Therapieoptionen samt Empfehlungen zur Beendigung von diesen sowie zu Antiresorptiva-assoziierten Kiefernekrosen (AR-ONJ) runden diese Fortbildung ab.





Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie,
Chefärztin, Innere Medizin I, St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig
- Pneumologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Chirurgie - Orthopädie und Unfallchirurgie
Die Rolle der Osteoprotektion bei Patienten mit Lungenkarzinom
Die Rolle der Osteoprotektion bei Patienten mit Lungenkarzinom
Das Lungenkarzinom gehört weltweit zu den häufigsten Tumorerkrankungen. Bereits zum Zeitpunkt der Diagnose weisen ca. 40 % der Patienten Fernmetastasen auf, wobei ossäre Metastasen oft zu skelettalen Ereignissen (SREs) wie pathologische Frakturen und Rückenmarkskompressionen führen. Aus diesem Grund kommt der Osteoprotektion eine essenzielle Rolle bei Patienten mit Lungenkarzinom zu und wird im Rahmen dieser Fortbildung von Frau Dr. Gütz besprochen. Erfahren Sie dabei das Wichtigste zur Häufigkeit von ossären Metastasen und wie diese das Überleben, die Prognose und die Lebensqualität der Betroffenen beeinflussen. Sie erhalten wertvolle Informationen zu osteoprotektiven Maßnahmen und wie diese zur Vermeidung von SREs und zur Verbesserung des Überlebens eingesetzt werden können. Zudem gibt Frau Dr. Gütz praxisrelevante Empfehlungen zum adäquaten Monitoring und zur Co-Medikation und bespricht die Prävention und Überwachung von Nebenwirkungen wie Kieferosteonekrosen. Nutzen Sie diese Fortbildung, um Ihr Wissen über die Versorgung Ihrer Patienten mit Lungenkarzinom und Knochenmetastasen evidenzbasiert zu vertiefen.



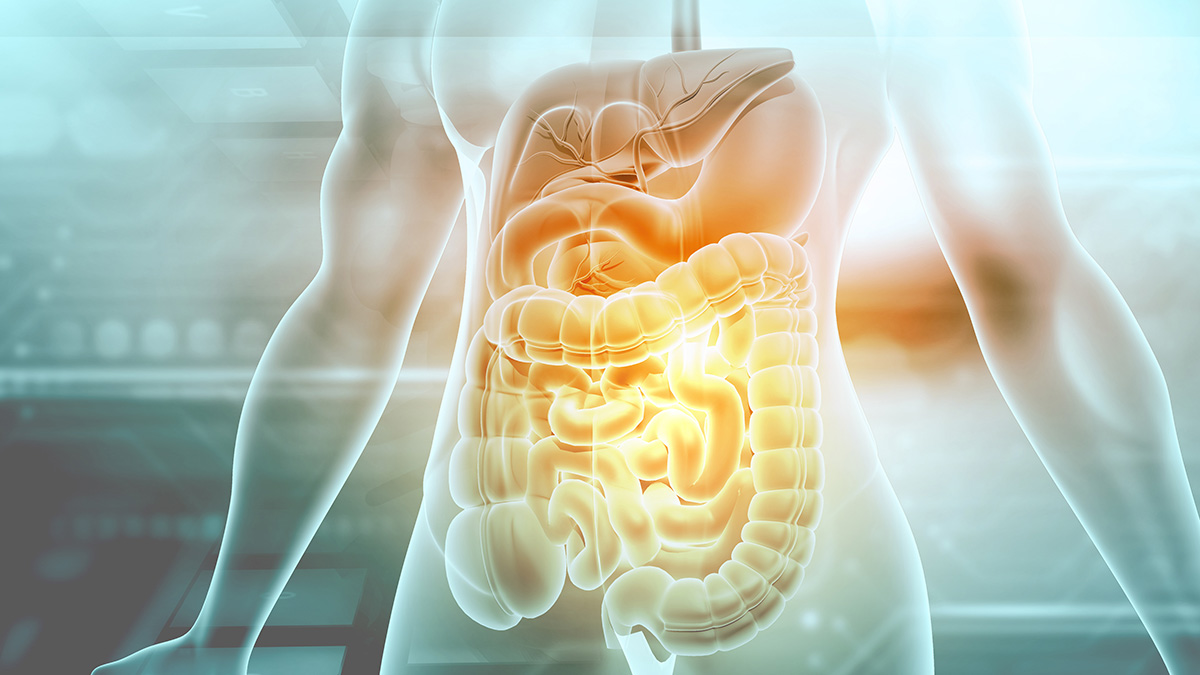

Internist, Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Palliativmedizin, Intensivmedizin;
Centrum für Hämatologie und Onkologie Bethanien
- Gastroenterologie / Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Biomarker FGFR2 bei Gastrointestinalen Tumoren
Biomarker FGFR2 bei Gastrointestinalen Tumoren
Biomarker sind biologische Merkmale, die im Blut oder in Gewebeproben gemessen und bewertet werden können. Sie zeigen krankhafte Veränderungen auf, können aber auch biologisch normale Prozesse im Körper nachweisen. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Waidmann Alterationen an FGFR-Signalwegen mit Fokus auf den Biomarker FGFR2 bei Gastrointestinalen Tumoren. Es werden insbesondere die Therapiekonzepte FGFR2-Inhibitoren und monoklonale Antikörper und deren Einsatz beim Cholangiokarzinom sowie Magenkarzinom/AEG-Tumor besprochen. Die dazugehörigen Studienergebnisse der Studien FIGHT 202, FOENIX-CCA2 und FIGHT sowie die Empfehlungen der Leitlinien runden diese Fortbildung ab.





Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie;
Geschäftsführender Oberarzt; Abteilung für Nephrologie;
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
- Nephrologie / Angiologie / Kardiologie / Innere Medizin
Atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD) bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD)
Atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD) bei Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD)
Atherosklerotische kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD) gehören zu den Hauptursachen für Morbidität und Mortalität. Dies ist unter anderem für Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) wichtig, da diese ein hohes bzw. sehr hohes kardiovaskuläres Risiko aufweisen. Im Rahmen dieser Fortbildung bespricht Herr Prof. Schmaderer das Wichtigste zur ASCVD bei CKD-Patienten. Dabei wird zu Beginn der Fortbildung das kardiovaskuläre Risiko allgemein sowie bei CKD-Patienten und bei Dialysepatienten besprochen. Im weiteren Verlauf der Fortbildung wird insbesondere auf die Entstehung von Atherosklerose und Dyslipidämien bei CKD-Patienten eingegangen. Abgerundet wird diese Fortbildung durch Empfehlungen zum Lipidmanagement bei CKD-Patienten, die sowohl die empfohlenen Zielwerte, die Therapie mit Statinen und PCSK9-Inhibition als auch Blutdruckziele beinhalten. Berücksichtigung finden in dieser Fortbildung Empfehlungen der aktuellen kardiologischen und nephrologischen Leitlinien.
