

UNTERSTÜTZT DIESE CME:



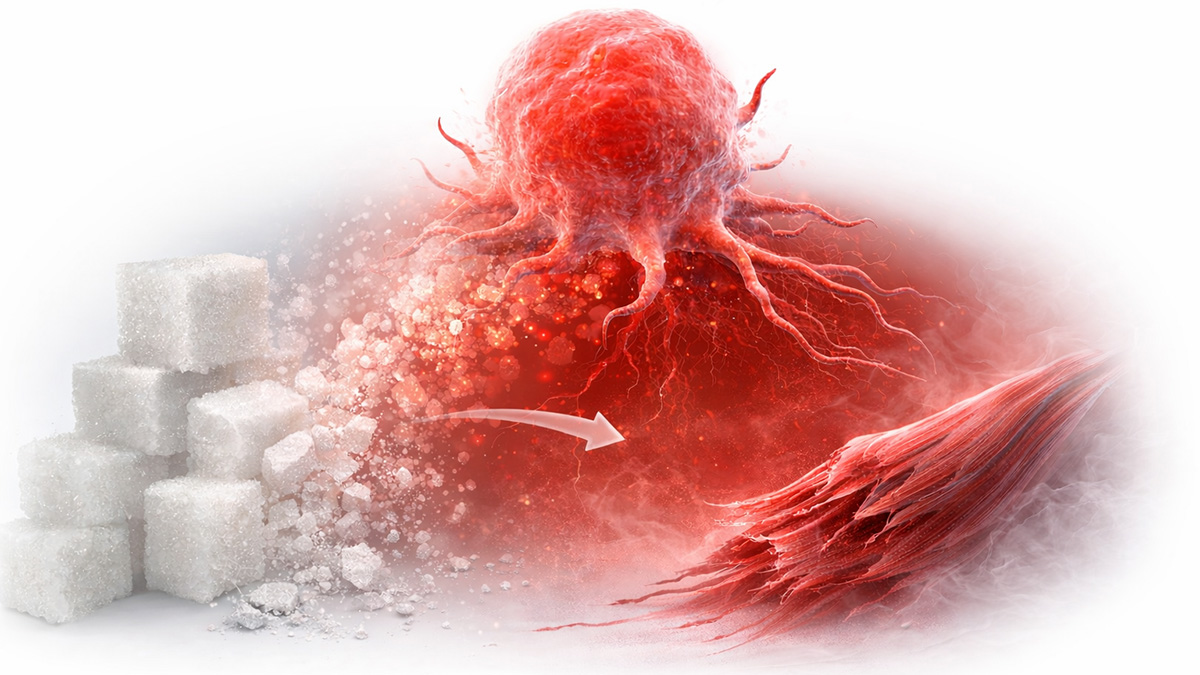

Facharzt für Innere Medizin, Ernährungstherapie DGEM und Proktologie
Eugastro Internistische Praxis, Leipzig
Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Diabetologie und Endokrinologie, St. Georg Klinikum Leipzig
- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin
Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie
Hyperglykämie und Insulinresistenz in der Onkologie
Die Diagnose einer Mangelernährung wird trotz vorhandener validierter Screeninginstrumente bei onkologischen Patienten oftmals erst spät oder sogar gar nicht gestellt. Entsprechend verzögert erfolgt in vielen Fällen eine bedarfsgerechte Ernährungstherapie, obwohl eine aktuelle Studie auch bei Krebspatienten die Vorteile einer gezielten Ernährungsintervention zeigt. Dabei können, abhängig vom Tumor, bis über 60 % der Krebspatienten von einer Mangelernährung betroffen sein. Während bei der Bilanzierung der Ernährungstherapie hauptsächlich auf die Eiweiß- und Kalorienversorgung geachtet wird, wird den Kohlenhydraten und der Glukose weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei können gerade Hyperglykämie und Insulinresistenz, die bei onkologischen Patienten zudem häufig sind, tumorfördernde Prozesse verstärken und den Verlauf der Erkrankung negativ beeinflussen, wie zahlreiche klinische Studien zeigen.
Herr Professor Schiefke sensibilisiert für die Bedeutung einer frühzeitigen, adäquaten Ernährungstherapie und zeigt, wie sich Mortalität, Therapieabbrüche, die Verträglichkeit der Tumortherapie und das Risiko einer Kachexie reduzieren lassen. Eine Mangelernährung verschlechtert die Prognose – ist jedoch in vielen Fällen vermeidbar.
