

UNTERSTÜTZT DIESE CME:





Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin, Professor für Kardiologie an der Universität Leipzig, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kardiologie am Universitätsklinikum Leipzig.
- Allgemeinmedizin / Angiologie / Innere Medizin / Kardiologie
Grundlagen der Lipidtherapie
Grundlagen der Lipidtherapie
Kardiovaskuläre Erkrankungen gehören zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Dabei zählt die Hypercholesterinämie zu den größten Risikofaktoren für die Entstehung von Atherosklerose und für die Pathogenese kardiovaskulärer Erkrankungen. Im Rahmen dieser Fortbildung werden die Grundlagen der Lipidtherapie ausführlich besprochen sowie die der Pathogenese atherosklerotischer Erkrankungen zugrundeliegenden Lipoproteine. Insbesondere wird auf die Bedeutung des LDL-C-Cholesterins eingegangen. Zudem werden die verschiedenen Therapieoptionen zur Senkung des LDL-Cholesterins diskutiert. Dabei finden bewährte Medikamente, neue Wirkstoffe sowie Empfehlungen aktueller Leitlinien Berücksichtigung.





Facharzt für Dermatologie
Schwerpunkt: Kinder- und Jugenddermatologie
Zusatzbezeichnung Allergologie
- Kinder- und Jugendmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten
Atopische Dermatitis - das ganze Kind und seine Familie im Blick
Atopische Dermatitis - das ganze Kind und seine Familie im Blick
Die atopische Dermatitis ist die häufigste chronische Hauterkrankung im Kindes- und Jugendalter und geht weit über sichtbare Hautsymptome hinaus – sie beeinflusst Schlaf, psychische Gesundheit, Bildungschancen und das gesamte familiäre Umfeld.
In dieser Fortbildung werden die komplexen pathogenetischen Mechanismen ebenso beleuchtet wie die hohe Krankheitslast, inklusive psychosozialer Folgen und Komorbiditäten. Teilnehmende Ärzte lernen, anhand aktueller Leitlinien praxisnah zwischen unterschiedlichen klinischen Subtypen zu differenzieren, Therapieziele alters- und schweregradabhängig zu definieren und Strategien zur Verbesserung der Adhärenz umzusetzen. Besondere Schwerpunkte liegen auf der frühen Erkennung schwerer Verläufe, der Indikation zur Systemtherapie sowie den Chancen und Hürden neuer Therapieansätze im Kindes- und Jugendalter. Fallbeispiele verdeutlichen, wie evidenzbasierte und patientenzentrierte Entscheidungen den Alltag der Betroffenen nachhaltig verbessern können.





Medizinische Klinik V, Medizinische Fakultät Mannheim, Universität Heidelberg, Deutschland
Klinisches Institut für Medizinische und Chemische Labordiagnostik, Medizinische Universität Graz, Österreich
SYNLAB Akademie, SYNLAB Holding Deutschland GmbH, Mannheim und Augsburg
- Allgemeinmedizin / Angiologie / Innere Medizin / Kardiologie
Fettstoffwechselstörungen - mögliche Hyperlipoproteinämien frühzeitig erkennen und diagnostizieren
Fettstoffwechselstörungen - mögliche Hyperlipoproteinämien frühzeitig erkennen und diagnostizieren
Störungen des Fettstoffwechsels (Hyperlipoproteinämie) sind klinisch häufig ohne Symptome. Wird die Hyperlipoproteinämie (HLP) jedoch nicht frühzeitig erkannt und behandelt, können die erhöhten Blutfette (Lipide) zu Folgeerkrankungen führen. Die Diagnose erfolgt mit Hilfe von Laboruntersuchungen, die im Wesentlichen drei Ziele haben:
- Abschätzung des kardiovaskulären Risikos,
- Diagnose einer spezifischen, oft primären Hyperlipoproteinämie,
- Etablierung der Indikation für nicht-medikamentöse und/oder medikamentöse Lipidsenkung.





Leiter Kinderpneumologie, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden
- Pneumologie / Kinder- und Jugendmedizin
Schweres Asthma in der Pädiatrie: von der Pathophysiologie bis zur Präzisionsmedizin
Schweres Asthma in der Pädiatrie: von der Pathophysiologie bis zur Präzisionsmedizin
Schweres Asthma bei Kindern und Jugendlichen stellt trotz moderner Therapien eine erhebliche klinische und psychosoziale Belastung dar. Dr. Prenzel beleuchtet die Pathogenese mit Fokus auf Barrierestörungen, Mikrobiomveränderungen und chronische Typ-2-Entzündung, die zu Remodeling, Mucusplugging und langfristigen Einschränkungen der Lungenfunktion führen. Prof. Vogelberg ergänzt die Thematik mit den aktuellen Leitlinienempfehlungen, Studiendaten und neuen Therapieoptionen, die zunehmend auf individualisierte Ansätze setzen. Die Fortbildung vermittelt praxisnah, wie sich Diagnostik, Risikostratifizierung und Therapieentscheidungen bei schwerem Asthma im Kindes- und Jugendalter evidenzbasiert umsetzen lassen.
Die Teilnehmenden gewinnen ein besseres Verständnis für die Krankheitslast und Pathomechanismen des schweren Asthmas, können die aktuellen Leitlinienempfehlungen kritisch einordnen und lernen, welche klinischen Marker eine frühzeitige Intervention erfordern. Zudem erfahren sie, wie sich Therapien im Hinblick auf Wirksamkeit, Sicherheit und langfristige Outcomes bewerten lassen und wie individualisierte Behandlungsstrategien im Praxisalltag umgesetzt werden können.





Medizinischer Direktor des BCRT Berliner Centrum für Reise- und Tropenmedizin, wissenschaftlicher Leiter des CRM Centrum für Reise- und Tropenmedizin Düsseldorf, Lehrbeauftragter der Universität zu Köln (Institut für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Hygiene), Consulting Expert der WHO und Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin / Innere Medizin / Kinder- und Jugendmedizin
Aktuelle Relevanz ausgewählter Reiseimpfungen
Aktuelle Relevanz ausgewählter Reiseimpfungen
Reiseassoziierte Infektionskrankheiten stellen auch in Zeiten postpandemischer Mobilität ein relevantes Risiko für international reisende Patienten dar.
Diese Fortbildung bietet Ärzt*innen einen aktuellen Überblick über zentrale, impfpräventable Erkrankungen, die im reisemedizinischen Kontext besonders relevant sind – darunter Influenza, Hepatitis A und B, Typhus, Tollwut, FSME, Japanische Enzephalitis, Meningokokken, Polio, Dengue und Gelbfieber. Die Inhalte basieren auf den aktuellen Empfehlungen der STIKO und werden durch praxisrelevante Hinweise zur Indikationsstellung, regionalen Risikobewertung und Impfberatung ergänzt.
Ziel der Fortbildung ist es, Teilnehmenden zu vermitteln, wie sie Reiserisiken differenziert einschätzen, individuelle Impfindikationen ableiten und Impfentscheidungen unter Berücksichtigung geografischer, saisonaler und patientenspezifischer Faktoren treffen können. Auch besondere Anforderungen bei bestimmten Patientengruppen – etwa bei VFR-Reisenden oder chronisch Kranken – werden praxisnah thematisiert.





Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Arbeitsmedizin
IMPFUNGEN - Vor und während der Schwangerschaft
IMPFUNGEN - Vor und während der Schwangerschaft
Verschiedene Infektionserkrankungen sind für eine signifikante Morbidität und Mortalität von Schwangeren, Feten und Säuglingen verantwortlich. Durch den Einsatz von Impfstoffen kann nicht nur die Schwangere, sondern durch den plazentaren Transfer von Antikörpern auch das Ungeborene vor impfpräventablen Infektionserkrankungen und schweren Krankheitsverläufen geschützt werden. Zugleich wird auch dem Neugeborenen durch Leihantikörper der Mutter ein Nestschutz gewährt.
Diese Fortbildung gibt einen Überblick, wann und gegen welche Infektionserkrankungen Frauen im gebärfähigen Alter und während der Schwangerschaft geimpft werden sollten, um sie selbst, den Fetus und auch das Neugeborene vor schwerwiegenden Krankheitsverläufen zu schützen.




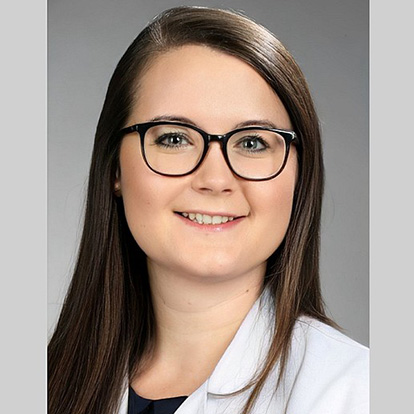
Leiterin der Ambulanz für kardiovaskuläre Prävention (Lipidambulanz)
V. Medizinische Klinik
Universitätsmedizin Mannheim
- Kardiologie / Innere Medizin
Primärprävention bei Hypercholesterinämie: Nutzen einer frühzeitigen lipidsenkenden Therapie bei Hochrisikogruppen
Primärprävention bei Hypercholesterinämie: Nutzen einer frühzeitigen lipidsenkenden Therapie bei Hochrisikogruppen
In dieser CME-Fortbildung wird die Prävention eines ersten kardiovaskulären Ereignisses bei Hochrisikopatienten, insbesondere bei Personen mit Typ-2-Diabetes und zusätzlichen Risikofaktoren wie peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) oder koronarer Herzkrankheit (KHK) thematisiert.
Prof. Perrone Filardi und PD Dr. Stach verdeutlichen eindrucksvoll, dass neben anderen Risikofaktoren besonders eine intensive, frühzeitige und konsequente Senkung des LDL-Cholesterins eine der effektivsten Maßnahmen zur Reduzierung des kardiovaskulären Risikos ist. Es werden aktuelle Studiendaten, internationale Leitlinienempfehlungen und praxisnahe Fallbeispiele vorgestellt, die den Teilnehmenden helfen, Hochrisikopatienten frühzeitig zu identifizieren, patientenspezifische Therapieziele zu definieren und die Versorgungslücke zwischen Leitlinie und klinischem Alltag zu schließen.
Diese Fortbildung unterstützt Sie dabei, Ihre Patienten langfristig vor schweren kardiovaskulären Ereignissen zu schützen und vermittelt wertvolle Impulse für die tägliche Praxis.





Facharzt für Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie, Transfusionsmedizin, Laboratoriumsmedizin
- Kinder- und Jugendmedizin / Allgemeinmedizin / Pneumologie
Pertussis - Eine unterschätzte Erkrankung
Pertussis - Eine unterschätzte Erkrankung
Bordetella (B.) pertussis ist ein kleines, gramnegatives, unbewegliches, bekapseltes, aerobes Stäbchenbakterium und der hauptsächliche Erreger von Pertussis.
Im Jahr 2024 erreichten die Pertussis-Fallzahlen in Deutschland einen Rekordhöchststand seit Einführung der bundesweiten Meldepflicht im Jahr 2013. Diese hohen Fallzahlen folgen einem langen Zeitraum mit niedrigen Fallzahlen, welche größtenteils auf die Infektionsschutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie zurückzuführen sind.
Im Gegensatz zum starken Anstieg der Fallzahlen erscheinen die Altersverteilung und die Schwere der Erkrankung unverändert zu sein. So bleibt Pertussis hochansteckend und betrifft alle Altersgruppen, wobei insbesondere Säuglinge ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben.
Diese zertifizierte Fortbildung gibt einen Überblick über das Krankheitsbild Pertussis und die aktuelle Relevanz in Deutschland. Zugleich wird auf das diagnostische Vorgehen sowie die derzeitigen Therapie- und Präventionsmaßnahmen eingegangen.




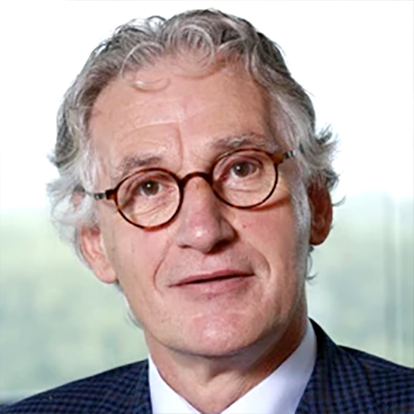
Facharzt für Allgemeinmedizin
- Allgemeinmedizin / Arbeitsmedizin
Allgemeines Impfmanagement von Patienten im Erwachsenenalter
Allgemeines Impfmanagement von Patienten im Erwachsenenalter
Impfungen sind ein effektiver Gesundheitsschutz und zählen zu den wirksamsten und wichtigsten Präventionsmaßnahmen in der modernen Medizin. In Deutschland werden von der unabhängigen Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut (RKI) jährliche Impfempfehlungen erlassen, die an die gegenwärtige nationale und internationale Situation angepasst werden. Auf dieser Grundlage empfehlen die obersten Gesundheitsbehörden der Länder Impfungen, die als schulmedizinischer Standard anzusehen sind und zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen
zählen. Trotz dieser Maßnahmen liegen in Deutschland noch immer Impfdefizite vor. Durch zu geringen Impfquoten und die unzureichende Einhaltung der Impfempfehlungen, z. B. bei den Auffrischimpfungen im Jugend- und Erwachsenenalter, können auch heutzutage noch Epidemien auftreten.
Als Schwerpunkt dieser zertifizierten Fortbildung werden verschiedene Krankheitsbilder und ihre Relevanz in Deutschland dargestellt sowie praxisrelevante Tipps für ein optimales Impfmanagement gegeben, um die zu betreuenden Patienten bestmöglich vor impfpräventablen Krankheiten zu schützen.





Oberarzt
Leitung Klassische Hämatologie und Hämostaseologie
Klinik für Hämatologie und Stammzelltransplantation
Westdeutsches Tumorzentrum Essen
Universitätsmedizin Essen (AöR)
- Hämatologie und Onkologie / Kardiologie
Diagnostik und Therapie der Kälteagglutininerkrankung (CAD)
Diagnostik und Therapie der Kälteagglutininerkrankung (CAD)
Die Kälteagglutininerkrankung (CAD) ist eine selten Autoimmunerkrankung, der eine lymphoproliferative B-Zell-Erkrankung zugrunde liegt. Diese Fortbildung bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Pathophysiologie, Diagnostik und Therapie der CAD, mit besonderem Fokus auf aktuelle und innovative Behandlungsansätze. Herr Professor Röth erläutert sowohl die B-Zell-gerichtete Immunchemotherapie als auch die Komplementinhibition als zentrale Therapiestrategien und stellt vielversprechende neue Behandlungsmöglichkeiten vor.
Teilnehmende Ärzte erhalten praxisnahe Einblicke in die sicheren Diagnosekriterien, die individuelle Therapieauswahl und die Integration moderner Therapiekonzepte in den klinischen Alltag.





Interventioneller Kardiologe mit dem Schwerpunkt Bildgebung sowie Leiter des kardiologischen Hochschulambulanz-Zentrums am Universitätsklinikum Augsburg
- Angiologie / Kardiologie / Radiologie
Koronare Bildgebung
Koronare Bildgebung
Anhand eines klinischen Patientenfalles mit Verdacht auf Perimyokarditis führt Herr PD Dr. Bittner in das Thema dieser Fortbildung, die koronare Bildgebung, ein. Nach einem Einblick in die Pathohistologie, insbesondere in die Atherom Klassifikation, wird im Folgenden der Fokus auf die invasive und nicht-invasive Diagnostik gelegt. Mit Hilfe von Bildbeispielen werden die unterschiedlichen bildgebenden Verfahren wie IVUS, NIRS, OCT sowie die koronare CT-Angiographie vorgestellt und ihre Bedeutung für die Diagnostik der koronaren Herzerkrankung näher beleuchtet. Verschiedene Therapiestrategien werden am Ende des Vortrags präsentiert und der Einfluss medikamentöser Wirkstoffe auf kardiovaskuläre Ereignisse, Plaque-Volumen und Plaque-Morphologie betrachtet.




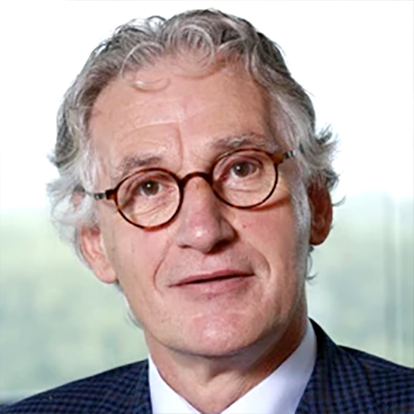
Facharzt für Allgemeinmedizin
- Allgemeinmedizin / Geriatrie / Arbeitsmedizin / Kardiologie / Hämatologie und Onkologie
Impfen von Risikogruppen
Impfen von Risikogruppen
Schutzimpfungen zählen zu den wichtigsten Präventivleistungen in der Hausarztpraxis. Grundsätzlich sollte der Impfstatus von Patienten bei jedem Arztbesuch überprüft und ggf. nach den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) vervollständigt werden.
Neben den regulären Standardimpfungen empfiehlt die STIKO für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch Impfungen auf Grund individueller oder beruflicher Indikation.
In dieser Fortbildung werden die aktuell von der STIKO empfohlenen Indikationsimpfungen für ausgewählte Risikogruppen sowie für Patienten mit erhöhtem beruflichem Risiko vorgestellt. Ausgegangen wird dabei nicht von der Impfung – wie es beispielsweise von der STIKO in den jährlichen Empfehlungen gehandhabt wird – sondern praxisorientiert von der jeweiligen Indikation wie dem (chronischen) Krankheitsbild oder der jeweiligen Lebensweise/-phase des Patienten.





Chefarzt Brüderklinik Julia Lanz, Ärztlicher Direktor Mannheimer BBT-Krankenhäuser.
Facharzt für Innere Medizin, Gastroenterologie, Diabetologe, Ernährungsmedizin (DGEM, DAEM), Zertifikat Onkologische Gastroenterologie der DGVS, Notfallmedizin
- Gastroenterologie / Innere Medizin
Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie
Eosinophile Ösophagitis - Diagnose und Therapie
Die eosinophile Ösophagitis (EoE) ist eine chronische, systemische und immunvermittelte Erkrankung der Speiseröhre, charakterisiert durch Symptome einer ösophagealen Dysfunktion und eine prädominante eosinophile Entzündung der Ösophagusschleimhaut.
In Teil 1 gibt Ihnen Herr Dr. Brückner einen praxisnahen Einblick in Pathophysiologie, Anamnese und Diagnosestellung der EoE.
Im 2. Teil stellt Ihnen Herr Prof. Schilling die aktuellen Behandlungsoptionen gemäß Leitlinie der deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen vor. Besonderer Fokus liegt auf der Rolle von Eliminationsdiäten, der medikamentösen Therapie sowie innovativen Ansätzen zur Langzeitkontrolle der Erkrankung.
In dieser Fortbildung erfahren Sie, wie Sie die diagnostischen Kriterien sicher anwenden, die Therapiewahl individuell auf den Patienten abstimmen und langfristig Therapieziele wie Symptomfreiheit, endoskopische und histologische Remission erreichen können.





Fachärztin für Dermatologie und Venerologie,
Oberärztin, Leitung CRC, Unterrichtsbeauftragte,
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
- Haut- und Geschlechtskrankheiten
Chronisch spontane Urtikaria (CSU) - Blick auf die Versorgungssituation und innovative Therapieansätze
Chronisch spontane Urtikaria (CSU) - Blick auf die Versorgungssituation und innovative Therapieansätze
Diese 2-teilige CME behandelt die chronisch spontane Urtikaria (CSU), eine häufig auftretende Hauterkrankung, die durch plötzlich auftretende Quaddeln und/oder Angioödem sowie Juckreiz gekennzeichnet ist und die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Im ersten Teil dieser Fortbildung vermittelt Frau Prof. Staubach aktuelle Erkenntnisse zur Pathophysiologie der CSU sowie zur Diagnosestellung und zum Monitoring der Krankheitslast. Im zweiten Teil wagt Herr Prof. Martin Metz einen Blick in die Zukunft. Dabei legt er ein besonderes Augenmerk auf neue Therapieansätze, das Krankheitsmanagement und die Bedeutung einer individualisierten Patientenversorgung.
Ziel dieser Fortbildung ist es, Ihnen praxisorientierte Strategien an die Hand zu geben, um die Herausforderungen in der Behandlung der CSU zu bewältigen. Diese Fortbildung bietet Ihnen Gelegenheit, Ihr fundiertes Wissen weiter zu vertiefen.
