Aktuelle CME
Eine Auswahl an CME zu allgemeinärztlichen Themen, die auch zur regelmäßigen Wissensauffrischung geeignet sind, finden Sie hier.





F.E.B.U.
Facharzt für Urologie
Zusatzbezeichnungen Medikamentöse Tumortherapie, Andrologie, Notfallmedizin und Naturheilverfahren
Chefarzt Urologie und Kinderurologie, Klinikum Coburg
- Allgemeinmedizin / Urologie / Naturheilverfahren / Innere Medizin
Nykturie im Praxisalltag - Definition, Diagnostik und ursachenangepasste Therapie
Nykturie im Praxisalltag - Definition, Diagnostik und ursachenangepasste Therapie
Die Ursachen der Nykturie sind vielfältig und oft multifaktoriell. Sie betrifft Menschen unterschiedlichen Alters, tritt aber mit zunehmendem Alter häufiger auf. Die wiederholte Unterbrechung des Nachtschlafes führt zu einem alltagsrelevanten Schlafdefizit, das Konzentration, Leistungsfähigkeit und damit die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt.
In vielen urologischen Leitlinien wird die Nykturie zwar erwähnt, eine spezielle Leitlinie für die Nykturie gibt es jedoch nicht. Diese CME vermittelt Ihnen praxisorientiertes Wissen über Pathophysiologie, interdisziplinäre Diagnostik und aktuelle Therapieoptionen der Nykturie.
Eine strukturierte Anamnese bildet die Grundlage für die Einordnung möglicher Ursachen und eine zielgerichtete, individuelle Therapieplanung. Von verhaltenstherapeutischen Maßnahmen, einer Änderung des Lebensstils bis hin zu medikamentösen Behandlungsoptionen einschließlich der Phytotherapie stehen verschiedene Therapieansätze zur Verfügung.
Nutzen Sie diese Fortbildung zur Optimierung Ihrer Behandlungsstrategien – zum Wohle der Lebensqualität Ihrer Patientinnen und Patienten.





Professor für Männergesundheit, Hamburg
Urologe, Androloge und Sexualmediziner (FECSM)
- Allgemeinmedizin / Urologie / Innere Medizin
Männergesundheit am Beispiel der erektilen Dysfunktion: aktuelle Versorgungslage in Deutschland
Männergesundheit am Beispiel der erektilen Dysfunktion: aktuelle Versorgungslage in Deutschland
Die Männergesundheit ist ein zentraler, jedoch oft vernachlässigter Aspekt der medizinischen Versorgung in Deutschland. Die aktuelle Versorgungslage zeigt deutliche Defizite, die am Beispiel der Erektilen Dysfunktion (ED) verdeutlicht werden können. Diese Erkrankung, die als wichtiger Indikator für die allgemeine Männergesundheit gilt, ist eine häufige “Volkskrankheit”.
Eine adäquate Diagnostik der Ursachen ist entscheidend, da ED in vielen Fällen heilbar zu sein scheint. Um die Versorgung zu verbessern, sind individualisierte Therapiekonzepte und innovative Ansätze unabdingbar. Nur durch einen unterschwelligen frühen Therapiebeginn und gezielten Maßnahmen lässt sich die Lebensqualität und Gesundheit betroffener Männer nachhaltig steigern.





Facharzt für Anästhesiologie, Intensivmedizin, Schmerztherapie, Palliativmedizin, Akupunktur
Chefarzt Abteilung Anästhesie / Intensivmedizin / Schmerzmedizin Cura, GFO Kliniken Bonn
Lehrbeauftragter der Universität Bonn, Sprecher Arbeitskreis Tumorschmerz Deutsche Schmerzgesellschaft, Mitglied des ständigen Beirats der Deutschen Schmerzgesellschaft
- Endokrinologie und Diabetologie / Innere Medizin / Urologie / Anästhesiologie / Palliativmedizin
Testosteronmangel - eine oft unerkannte Nebenwirkung von Opioiden und Koanalgetika
Testosteronmangel - eine oft unerkannte Nebenwirkung von Opioiden und Koanalgetika
Opioide werden aufgrund ihrer hohen analgetischen Potenz immer häufiger zur Therapie starker chronischer Schmerzen eingesetzt. Über bekannte Nebenwirkungen wie Obstipation, Übelkeit und Erbrechen hinaus kann sich die Anwendung von Opioiden allerdings auch negativ auf die körpereigene Testosteronproduktion auswirken. Viele männliche Patienten entwickeln daher unter einer längerfristigen Opioidtherapie einen opioidinduzierten Testosteronmangel, der oft mit spürbaren Symptomen assoziiert ist. Ein solcher durch Opioide ausgelöster männlicher Hypogonadismus wird jedoch häufig von Ärztinnen und Ärzten nicht erkannt.
Der Schmerzspezialist Priv.-Doz. Dr. Stefan Wirz (GFO-Kliniken Bonn, Betriebsstätte Cura Krankenhaus, Bad Honnef) stellt in dieser Fortbildung wichtige Studienergebnisse vor und berichtet über seine eigenen Erfahrungen zu diesem oft verkannten Krankheitsbild. Zudem gibt er praktische Tipps, wie die Beschwerden der Patienten wirksam gelindert und gleichzeitig deren Lebensqualität erhöht werden kann.



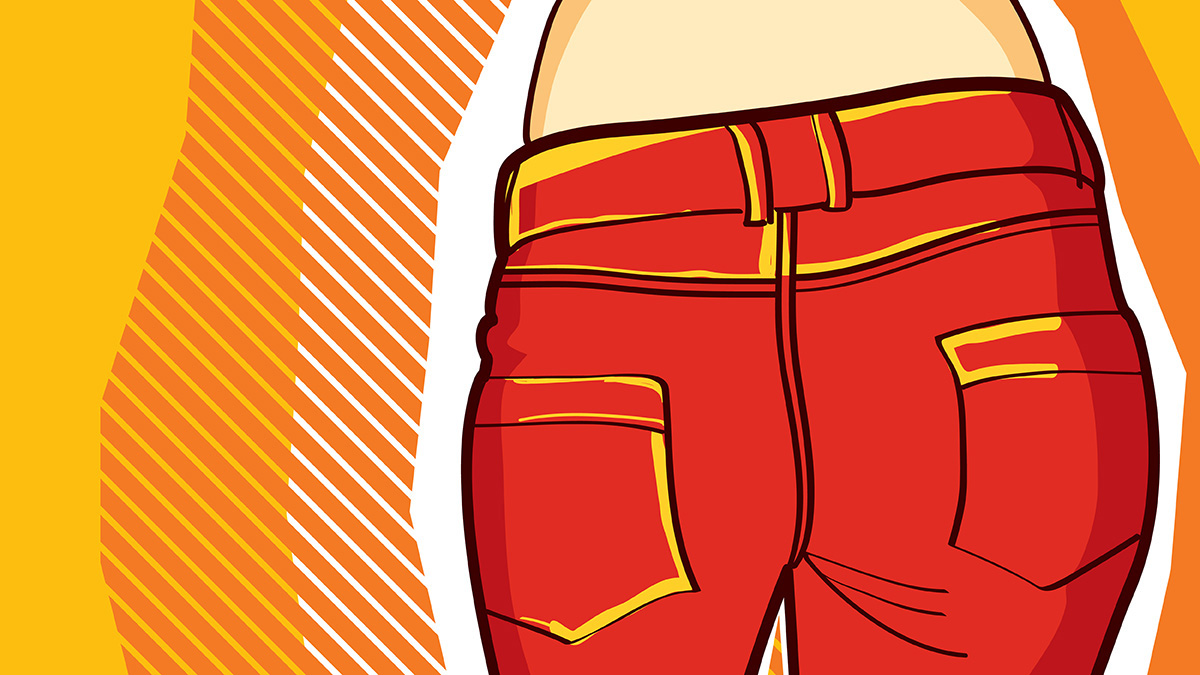

Facharzt für Allgemeinchirurgie, Facharzt für spezielle Viszeralchirurgie Zusatzbezeichnung Proktologie der Ärztekammer und Koloproktologie der European Society of Coloproctology (ESCP) edh End-& Dickdarmzentrum Hannover
- Allgemeinmedizin / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Urologie / Haut- und Geschlechtskrankheiten
Akutfall in der Praxis - Anorektaler Schmerz
Akutfall in der Praxis - Anorektaler Schmerz
Anorektaler Schmerz kann durch eine Vielzahl proktologischer Erkrankungen hervorgerufen werden. In dieser Fortbildung bekommen Kolleg:innen verschiedenster Fachrichten eine Handlungsstrategie mit auf den Weg, wie ein akuter Schmerz im analen und perianalen Bereich durch eine gezielte Anamnese gut diagnostiziert und konservativ behandelt werden kann.
Lernen Sie Schmerzursachen wie z.B. Analfissuren, perianaler Abszesse, Analrandthrombose, thrombosierter Analprolaps und Analkarzinom/Rektumkarzinom richtig einzuschätzen und vertiefen Sie Ihre Kenntnisse für eine präzise und wirksame Patient:innenversorgung.





Facharzt für Allgemeinchirurgie, Facharzt für spezielle Viszeralchirurgie Zusatzbezeichnung Proktologie der Ärztekammer und Koloproktologie der European Society of Coloproctology (ESCP) edh End-& Dickdarmzentrum Hannover
- Allgemeinmedizin / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Urologie / Chirurgie / Haut- und Geschlechtskrankheiten
Differentialdiagnosen des Hämorrhoidalleidens - Aus der Praxis für die Praxis
Differentialdiagnosen des Hämorrhoidalleidens - Aus der Praxis für die Praxis
Anhand der wesentlichen Leitsymptome gibt diese Fortbildung einen Überblick über Anamnese, Inspektion und Diagnose der häufigsten proktologischen Krankheitsbilder. Ausgehend vom Hämorrhoidalleiden, der mit einer Lebenszeitprävalenz von 70 % häufigsten proktologischen Erkrankung, werden die wesentlichen Differentialdiagnosen anhand von Blickdiagnosen gezeigt und basistherapeutische Maßnahmen vorgestellt. So werden Kolleg:innen aus anderen Fachgebieten gestärkt, die häufigsten proktologische Erkrankungen mit einfachen Mitteln zu diagnostizieren und basistherapeutisch zu behandeln.



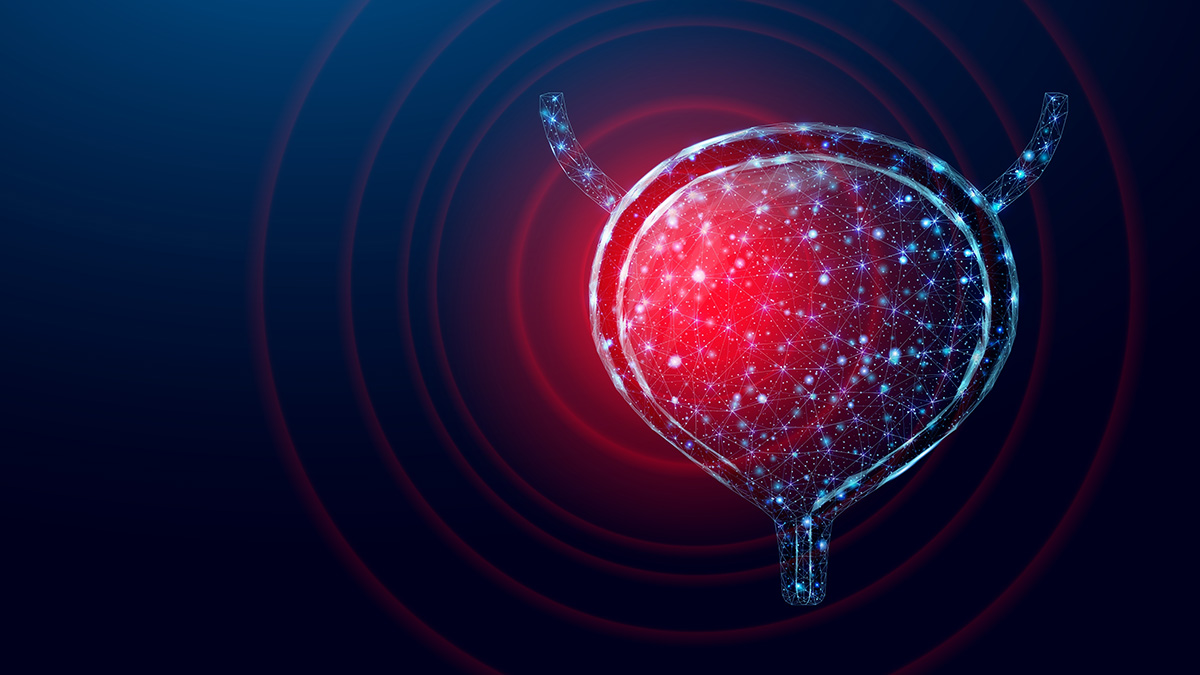

Chefarzt der Urologie, Asklepios Klinik Altona
Hamburg
- Hämatologie und Onkologie / Urologie
Nicht-muskelinvasives Blasenkarzinom - heutige und künftige Therapieoptionen
Nicht-muskelinvasives Blasenkarzinom - heutige und künftige Therapieoptionen
Das Harnblasenkarzinom zählt weltweit zu den zehn häufigsten Krebserkrankungen, wobei in der Europäischen Union eine signifikante geschlechterspezifische Inzidenz beobachtet wird. Der Großteil der Diagnosen entfällt auf das nicht-muskelinvasive Harnblasenkarzinom.
In dieser Fortbildung präsentiert Herr Prof. Wülfing die S3-Leitlinien sowie die neuesten EAU Guidelines 2024 zum Harnblasenkarzinom. Im Fokus stehen Ätiologie, Früherkennung/Diagnostik, Staging und Grading sowie das Risikomanagement. Zudem wird die aktuelle Studienlandschaft mit innovativen Wirkstoffsystemen, -klassen und Kombinationstherapien erörtert.
Weitere Themen umfassen die Chemotherapie-Frühinstillation, adjuvante Therapieempfehlungen und moderne Alternativen zur BCG-Therapie, insbesondere die Handhabung bei BCG-Intoleranz und -Versagen. Ziel ist es, Ihnen fundierte Einblicke und aktuelle Empfehlungen zur Optimierung der Therapie sowie Ausblicke auf zukünftige Therapiemöglichkeiten zu bieten.





Fellow of the Royal Society of Medicine, Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologe, Diabetologe, Androloge, Sexualmediziner (FECSM), Geschäftsführender Oberarzt am Centrum für Reproduktionsmedizin und Andrologie, Universitätsklinikum Münster, Klinischer Androloge der Europäischen Akademie für Andrologie (EAA)
- Innere Medizin / Endokrinologie und Diabetologie / Urologie / Psychiatrie und Psychotherapie
Testosteron und Psyche: Wirkung auf Stimmung, Lebensqualität und Kognition
Testosteron und Psyche: Wirkung auf Stimmung, Lebensqualität und Kognition
Das männliche Sexualhormon Testosteron beeinflusst nicht nur die physischen Körperfunktionen wie beispielsweise Muskelstärke oder penile Funktion – es hat auch eine Wirkung auf die Psyche des Mannes. Brachte man früher insbesondere risikoaffines und aggressives Verhalten in Zusammenhang mit Testosteron, so sieht man die Zusammenhänge heute differenzierter. Mittlerweile ist bekannt, dass Testosteron vielmehr Verhaltensweisen fördert, die auf den Erhalt des sozialen Status bzw. auf eine generelle Motivation zielen. Dieser Erkenntnis folgend kann ein männlicher Hypogonadismus auch zu Niedergeschlagenheit, reduzierter Selbstwahrnehmung und sogar zu Depressionen führen.
Prof. Michael Zitzmann, tätig am Centrum für Reproduktionsmedizin & Andrologie in Münster, geht in dieser Fortbildung der Frage nach, inwiefern sich bei hypogonadalen Männern eine Testosterontherapie auch auf die Psyche auswirkt. Hierzu stellt er wichtige Studienergebnisse vor und zeigt, wie die daraus resultierenden Erkenntnisse in den Praxisalltag übertragen werden können.



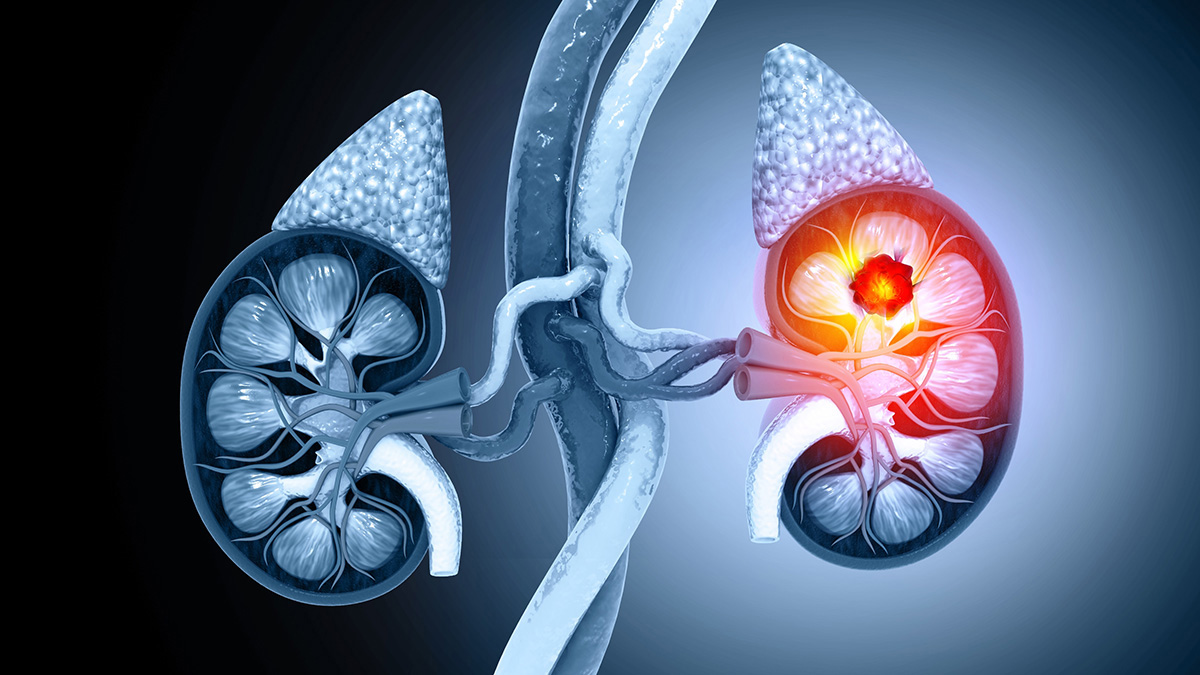

Chefärztin der Klinik für Urologie
Krankenhaus Nordwest, Frankfurt am Main
- Hämatologie und Onkologie / Innere Medizin / Nephrologie / Urologie
Therapie des nicht metastasierten und metastasierten Nierenzellkarzinoms (NZK)
Therapie des nicht metastasierten und metastasierten Nierenzellkarzinoms (NZK)
Unter allen Nierentumoren im Erwachsenenalter treten die Nierenzellkarzinome (NZK, engl. RCC) mit einem Anteil von circa 95 % am häufigsten auf. Im Jahr 2020 gab es allein in Deutschland über 14.000 Neuerkrankungen, Männer waren dabei deutlich häufiger betroffen als Frauen.
In dieser Online-Fortbildung stellen Ihnen die beiden Experten Prof. Dr. Inga Peters und PD Dr. Philipp Ivanyi neueste Erkenntnisse zur Behandlung des nicht metastasierten und metastasierten Nierenzellkarzinoms vor. Der erste Teil widmet sich den Therapieoptionen des lokal begrenzten oder fortgeschrittenen Stadiums und präsentiert Studiendaten zur adjuvanten Therapie. Der zweite Teil führt Sie durch einen Therapiealgorithmus des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mNZK, engl. mRCC) und beleuchtet aktuelle Daten immunonkologischer Kombinationstherapien (IO/TKI, IO/IO) sowie Kriterien zur differenzierten Therapieauswahl in der Erstlinie des mNZK.





Facharzt für Allgemeinchirurgie, Facharzt für spezielle Viszeralchirurgie Zusatzbezeichnung Proktologie der Ärztekammer und Koloproktologie der European Society of Coloproctology (ESCP) edh End-& Dickdarmzentrum Hannover
- Allgemeinmedizin / Haut- und Geschlechtskrankheiten / Urologie / Frauenheilkunde und Geburtshilfe / Chirurgie - Allgemeine Chirurgie
Hilfe es juckt - Analer Juckreiz im Praxisalltag
Hilfe es juckt - Analer Juckreiz im Praxisalltag
Diese eCME soll allgemeinärztlich tätigen Kolleg:innen einen strukturierten Überblick über die analen Dermatosen und deren Therapiemöglichkeiten geben. Sie soll dabei helfen mit dem schwierigen Thema "Analer Juckreiz" im Praxisalltag besser umgehen zu können.
Das Thema wird "vom Häufigen zum Seltenen" erarbeitet – immer mit dem Hintergrund der Praxisrelevanz und sinnvollen Umsetzbarkeit. Verschiedene Formen von Ekzemen, Psoriasis inversa, Herpes simplex Infektionen, Mykosen, bakterielle Dermatosen sowie Lichen und "Pruritus sine materia" können der Auslöser für analen Juckreiz sein. Diese Fortbildung beschäftigt sich mit diesen verschiedenen Krankheitsformen und beschreibt Ursachen, Symptomatik und Therapiemöglichkeiten.